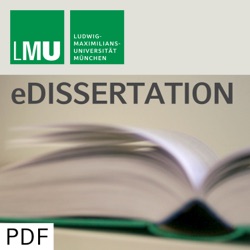Episódios
-
Die moderne Astrophysik steht vor der Herausforderung, neueste
Beobachtungen mit den theoretischen und numerischen Modellen der
Galaxienentstehung und -entwicklung zu konfrontieren. So hofft man, die
wichtigsten physikalischen Prozesse und ihre Zeitskalen identifizieren zu
koennen.
In dieser Arbeit nehmen wir eine komplette, helligkeits--limitierte Auswahl
von 1862 Galaxien aus der Sloan Digital Sky Survey (SDSS), um eine Anzahl
von globalen und strukturellen Parametern zu untersuchen. Diese Auswahl
beinhaltet helle Objekte mit einer r--Band Helligkeit von < 15.9 im nahen
Universum mit einer Rotverschiebung von z < 0.12. Sie enthaelt
elliptische, Spiral- und irregulaere Galaxien. Photometrische Daten sind
fuer die u, g, r, i und z--Baender angegeben und von 1588 Galaxien
wurden
nachtraeglich Spektra genommen. Die `Bulge' Komponente der Galaxien
wird mit Sersic und de Vaucouleurs Modellen modelliert, waehrend die
Scheibenkomponente mit einer exponentiellen Verteilung modelliert wird.
Die Messung des Lichtanteils in `Bulge' und Scheibenkomponente gibt
Aufschluss ueber die Effizienz des hierarchischen
Strukturbildungsprozesses.
In Kapitel 3 zeigen wir, dass der mittlere Anteil des
Lichts aus der
Scheibe stark mit der totalen absoluten Helligkeit der Galaxie zunimmt.
Unabhaengige r und i Band Analysen ergeben einen sehr aehnlichen Trend.
Zum ersten Mal schaetzen wir den volumengemittelten Anteil des Lichts aus
der Scheibenkomponente von Galaxien ab und stellen fest, dass ungefaehr
(55 +- 2) % des gesamten Lichts im lokalen Universum aus Scheiben kommt.
Wir ermitteln auch die Leuchtkraftfunktion fuer reine 'Bulges', also fuer
Strukturen ohne Scheibenanteil, die nicht einfache Spheroide sind.
In Kapitel 4 studieren wir die Abhaengigkeiten von visuellen und
quantitativen morphologischen Klassifikationskriterien mit dem Ziel
sauberere Galaxienkataloge zu erstellen, besonders bei hohen
Rotverschiebungen, wo die Klassifikation schwierig ist. Wir finden, dass
Galaxienfarben, effektive Oberflaechenhelligkeit, Masse/Licht Anteil, und
Asymmetrie Parameter einen Mehrparameter Raum aufspannen, in der alle
Galaxien je nach morphologischem Typ eindeutig positioniert sind.
In Kapitel 5 beobachten wir einen klaren Trend, mit dem die Skalenlaenge
der Scheiben mit ihrer Helligkeit zunimmt, und dieser Trend ist
unabhaengig vom photometrischen Band und der morphologischen Klasse. Es
existiert auch eine klare Abhaengigkeit zwischen dem effektiven Radius des
`Bulge' und seiner Helligkeit, aber die Steigung dieser Relation aendert
sich mit dem morphologischem Typ. Sie ist steiler fuer fruehere Typus, was
uns zu der Schlussfolgerung fuehrt, dass die Skalenlaenge weniger von der
Morphologie abhaengt als die Skalenlaenge des `Bulges'. Dies legt nahe,
dass `Bulges' in fruehen und spaeteren Galaxien in unterschiedlichen
Prozessen gebildet werden. Wir finden auch eine Korrelation zwischen den
strukturellen Parametern von Scheiben und `Bulges', insbesondere zwischen
effektivem Radius der `Bulges' und der Skalenlaenge der Scheiben in
Systemen fruehen Typus. Wir interpretieren dies als Beweisstueck
zugunsten von saekularen Evolutionsmodellen. -
This work presents the results of a detailed study of the statistical and physical properties of binary ultracool dwarfs and brown dwarfs (spectral type later than M7).
As for the statistical properties, we found that the frequency of binaries among ultracool objects is significantly lower than for earlier type objects, with a lower limit at 10--15% in the field, and <10% in the Pleiades Open cluster. While we were sensitive to systems with separations up to 100 A.U, we did not find any multiple system with separation greater than 20 A.U. At even larger separations, no wide binaries were reported by the all sky surveys such as 2MASS, DENIS or SDSS. The distribution of separations looks similar to that of F and G dwarfs (Gaussian), but with a peak at 4--8 A.U. Although we were sensitive to mass ratios down to 0.65, we found most of the objects to have mass ratios larger than 0.85. This latter result needs to be confirmed by further statistical studies on well defined statistical samples. Although the sample of known binaries in the Pleiades is too small for a similar analysis, we note that the binary frequency, the distributions of mass ratio and separations are similar, indicating that the properties of binary brown dwarfs might not depend on the age and environment after 125 Myr. Finally, although we did not have the opportunity to perform a similar statistical study in a star forming region, we report the first detection of a young binary brown dwarf with a disk in the R-CrA association.
These results provide strong constraints on the models of ultracool dwarf formation and evolution. The binary frequency is currently not reproduced by any of these models. The models of ejection could explain the lack of binaries wider than 20 A.U and the apparent preference for equal mass systems, but they predict a much lower binary frequency. The model assuming that brown dwarfs form in a smilar way than stars could reproduce the binary frequency we observe, but could not explain the distributions of separation and mass ratio. More efforts are required on the theoretical side in order to better explain the observed properties, and on the observational side to give new and improved constraints.
As for the physical properties, our observations lead to the discovery of a short period binary L dwarf. Observations at high angular resolution spread over 4 years allowed us to follow the companion on 60% of its orbit. For the first time, we were then able to compute the orbital parameters and total mass of such a very low mass object. In the near future, similar studies should enable us to calibrate brown dwarf mass and luminosity models. Using high angular resolution spectroscopy, we were able to disentangle the spectra of the individual components of 4 binary ultracool dwarfs and to compute their spectral types. Two binaries have companions with spectral types significantly later than their primary (by 3 to 4 spectral subclasses), allowing us to compare the evolution of their effective temperature and atmosphere. Finally, using our high angular resolution images, we were able to detect a possible third component in one of the binaries of our sample. -
Estão a faltar episódios?
-
Die Arbeit liefert neue Beiträge zu zwei wichtigen biophysikalischen Fragestellungen der Peptid-/Proteinfaltung: 1. Welchen Einfluss hat das Lösungsmittel auf die initiale Konformationsdynamik? Das Molekül Azobenzol dient dazu, gezielt in einem ringförmigen Oktapeptid getriebene Konformationsänderungen auszulösen. Azobenzol isomerisiert nach Lichtanregung innerhalb weniger Pikosekunden. Es werden neue Ergebnisse zum Isomerisierungsmechanismus präsentiert, die wichtige Hintergrundinformationen zum Verständnis der Moleküldynamik liefern. Durch die Isomerisation ändert sich die Länge des Azobenzols um fast den Faktor zwei, wodurch in den Azobenzol-Peptiden konformationelle Umorganisationen ausgelöst werden. Bereits früher durchgeführte Messungen an DMSO-löslichen Azobenzol-Peptiden zeigten, dass kinetische Prozesse, die mit Zeitkonstanten von ~10ps und ~100ps ablaufen, der Bewegung des Peptid-Teils zugeordnet werden können. Die hier präsentierten Ergebnisse an Azobenzol-Peptiden, die in Wasser löslich sind zeigen, dass Prozesse auf Zeitskalen >5 ps in Wasser um den Faktor 1.5-2 beschleunigt ablaufen. Man sieht in diesen ultraschnellen Kinetiken echte Umorganisationen des Peptid-Rückgrats, deren Geschwindigkeit durch die Viskositat des Lösungsmittels bestimmt sind 2. Wie schnell ist die Kontaktbildung in Peptiden? Fur ein Verständnis der Proteinfaltung ist wichtig zu wissen, wie lange es dauert, bis zwei (räumlich entfernte) Aminosäuren innerhalb eines Peptids einen Kontakt ausbilden. Zur Bestimmung dieser Kontaktbildungsrate werden Experimente an Xanthon-Peptiden präsentiert, die zwei Marker-Moleküle enthalten. Messungen ergeben, dass der durch einen kurzen Lichtimpuls angeregte Donor Xanthon innerhalb weniger Pikosekunden einen langlebigen Triplett-Zustand besetzt. Weiterhin wird gezeigt, dass bei direktem Kontakt zum Akzeptor Naphthalin ein Triplett-Triplett Energietransfer innerhalb <=1 ps stattfindet. Das System Xanthon/Naphthalin bildet somit ein ideales Paar von Marker-Molekülen. In den hier untersuchten Peptiden sind Donor und Akzeptor durch zwei (bzw. sechs) Aminosäuren voneinander getrennt und man findet für alle Peptide zwei Zeitkonstanten für die Kontaktbildung. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Peptide im Gleichgewicht in zwei Sub-Ensembles vorliegen: etwa ein Viertel der Peptide befinden sich in einer eher kompakten Form, von der aus eine Kontaktbildung mit einer Zeitkonstanten von ca. 250 ps erfolgen kann, der Rest der Peptide ist in einer eher gestreckten Konformation und die Kontaktbildung erfolgt mit einer Zeitkonstanten im Bereich 6-14 ns.
-
In dieser Doktorarbeit studiere ich die Entstehung und Entwicklung von Galaxien in Galaxienhaufen sowohl theoretisch als auch unter Einbeziehung von Beobachtungsdaten. Diese Doktorarbeit gliedert sich in zwei Teile: Einem theoretischen Teil schliesst sich eine Datenanalyse an. Im ersten Kapitel beschreibe ich warum Galaxienhaufen wichtig sind, erklaere die Motivation und Zielsetzung der in dieser Arbeit verwendeten Analyse und erlaeutere den dafuer noetigen theoretischen Hintergrund als auch den Hintergrund fuer die Beobachtungen. Zuerst untersuche ich die Vorhersagen des hierarchischen `Modells der kalten dunklen Materie' fuer die beobachteten Eigenschaften der Population von Galaxien in Galaxienhaufen und fuer ihre Entwicklung als Funktion der kosmischen Rotverschiebung. Ich verwende eine grosse Anzahl von hochaufgeloesten numerischen Simulationen von Galaxienhaufen zusammen mit einer hochaufgeloesten Simulation einer `typischen' Region des Universums. Die grosse Aufloesung der verwendeten Simulationen ermoeglicht es mir, die Entwicklung der Zentren der dunklen Materiehalos zu verfolgen, welche mit groesseren Strukturen zusammenwachsen. Dies erlaubt eine eindeutige Identifizierung leuchtender Galaxien in den Haufen und Substrukturen der dunklen Materie. Diese Analyse ist Bestandteil des zweiten Kapitels. Um eine enge Verbindung zwischen den theoretische Vorhersagen und den Beobachtungen zu ziehen, entwickle ich ein semi-analytisches Programm, welches selbstkonsistent die photometrische und chemische Entwicklung der Galaxien in den Haufen, als auch die chemische Geschichte des Gases innerhalb der Haufen
und innerhalb der Galaxien verfolgt. Dabei modelliere ich den Transport von Masse und Metallen zwischen den Sternen, das kalte Gas in Galaxien, das heisse Gas in dunklen Materiehalos, und das intergalaktische Gas ausserhalb der
virialisierten Halos. Ausserdem modelliere ich die Effekte von Staub auf die emittierte Strahlung von Galaxien. Das dritte Kapitel beschreibt das semi-analytische Modell im Detail und zeigt einen Vergleich mit einer Anzahl von Beobachtungsergebnissen fuer Galaxien aus nahen Haufen. Im folgenden verwende ich dieses Modell, um die Anreicherung des intergalaktischen Mediums und des Gases innerhalb der Galaxienhaufen mit den chemischen Elementen als Funktion der Zeit zu studieren. Dabei untersuche ich, zu welchem Zeitpunkt der Grossteil der Anreicherung stattfand und welche Galaxien den groessten Beitrag lieferten. Im weiteren Verlauf analysiere ich die beobachtbaren Merkmale verschiedener Modelle von Rueckkopplungsmechanismen. Dabei zeige ich, dass die beobachtete Abnahme des baryonischen Massenanteils von Galaxienhaufen zu Gruppen nur in einem `extremen' Modell reproduziert werden kann, in welchem das
wiederausgestossene Material auf einer Zeitskala wiederaufgenommen wird, die vergleichbar mit der Hubblezeit ist. Die Resultate dieser Untersuchungen werden in Kapitel 4 praesentiert. Der zweite Teil meiner Doktorarbeit handelt von der Interpretation von Daten des `ESO Distant Cluster Surveys' (EDisCS). Dieses `ESO Large Program' hat das Ziel, die Entwicklung der Galaxien in Galaxienhaufen ueber mehr als 50 Prozent der kosmischen Zeit zu studieren. Es verbindet die photometrische und spektroskopische Information einer grossen Auswahl von Galaxienhaufen bei
Rotverschiebungen um 0.5 und 0.8. Ich fuehre eine detaillierte dynamische und strukturelle Analyse einer Untermenge der EDisCS Galaxienhaufen durch, fuer welche vollstaendige photometrische und spektroskopische Daten
vorhanden sind. Im besonderen entwickle ich eine Methode, um Substruktur zu quantifizieren, welche der projizierten raeumlichen Verteilung als auch der Geschwindigkeitsverteilung Rechnung traegt. Die Ergebnisse werden dann detailiert mit Resultaten der numerischen Simulation verglichen. Im Kapitel 5 diskutiere ich, wie die Erweiterung der Methode auf den gesamten EDisCS Datensatz wichtige Einschraenkungen auf die relative Bedeutung der
verschiedenen physikalischen Prozesse liefern wird, die Galaxienentwicklung in dichten Umgebungen beeinflussen. Zum Schluss analysiere ich die Farb-Helligkeits-Beziehung einer Untermenge der EDisCS Galaxienhaufen bei grossen Rotverschiebungen. Dabei vergleiche ich die erhaltenen Resultate der hochrotverschobenen Galaxienhaufen mit denjenigen des nahen Coma Galaxienhaufens und zeige, dass die hochrotverschobenen Galaxienhaufen ein Defizit an leuchtschwachen Galaxien der roten Sequenz im Vergleich zu denjenigen bei kleiner Rotverschiebung aufweisen. Dies deutet an, dass ein grosser Bruchteil der leuchtschwachen passiven Galaxien in Galaxienhaufen zum gegenwaertigen Zeitpunkt bei grossen Rotverschiebungen aktive Sternentstehung aufgewiesen haben koennten. Diese Aussage stimmt qualitativ mit den Vorhersagen des hierarchischen Modells ueberein. Diese Analyse wird in Kapitel 6 praesentiert. -
This thesis describes the search for the Higgs boson in H->WW(*) decays in
proton anti-proton collisions with data taken at the D0 experiment at the
Tevatron collider. The data set was taken between April 2002 and September 2003 and has an integrated luminosity of approximately 147 pb^-1. An analysis of the di-muon decay channel of the W pairs was developed which can be scaled to higher luminosities up to the full data set to be taken until 2009 at the Tevatron collider. The number of events observed in the current data set is consistent with expectations from standard model backgrounds. Since no excess is observed, cross-section limits at 95% confidence level for H->WW(*) production have been calculated both standalone and also in combination with other lepton decay channels. The production of W pairs is one major background in the search of H->WW(*) decays. Hence a first measurement of the WW production cross-section with the D0 experiment is presented. Experience gained during this analysis has shown the precise track reconstruction is an essential tool for both measurements. This thesis closes with a contribution to precise tracking in the ATLAS experiment at the future Large Hadron Collider (LHC). An alignment system for ATLAS muon drift chambers at the cosmic ray measurement facility at LMU Munich is presented. -
Die Spektroskopie eines verbotenen optischen Übergangs eines
einzelnen Ions verspricht ein optisches Frequenznormal mit einer
Genauigkeit im Bereich von 10^(-18) zu ermöglichen. Die
Vorraussetzungen dafür sind neben außergewöhnlich geringen
systematischen Frequenzverschiebungen des Referenzübergangs ein
hohes Maß an Kontrolle der Bewegung des Ions, realisiert durch
die Speicherung und Laserkühlung in einer Quadrupolfalle und die
daraus resultierende, praktisch unbegrenzte Beobachtungszeit.
Diese Arbeit beschreibt Experimente im Hinblick auf die
Realisierung eines der aussichtsreichsten Kandidaten für ein
optisches Frequenznormal, einem gespeicherten Indium-Ion.
Zunächst wird in Kapitel 2 das Konzept der Indium-Uhr, der
bisher experimentell erreichte Stand der Spektroskopie, mit einer
relativen Auflösung von 10^(-13), und eine Abschätzung
der limitierenden Verschiebungen des 1S0-3P0 Referenzübergangs
dargestellt. Kapitel 3 führt danach in das
Prinzip der Speicherung und die konkrete Umsetzung im
In+-Experiment ein, behandelt dabei auftretende Probleme und
liefert mögliche Lösungen.
In Kapitel 4 wird eine neu implementierte Methode der
Photoionisation von Indium-Atome vorgestellt, die mit nur einem
Laser bei 410 nm über eine Zweiphotonen-Anregung zur Ionisierung
führt. Gegenüber der bislang verwendeten Elektronenstoßmethode
konnte damit die Ionisierungseffizienz um zwei Größenordnungen
gesteigert, und so Probleme, die einen kontinuierlichen Betrieb
des Frequenznormals behindern, vermieden werden.
Im Hinblick auf eine Erhöhung der Mittelungszeit wurde ein
kontinuierlich betreibbares Kühllasersystem aufgebaut, das in Kapitel 5 beschrieben wird. Ein gitterstabilisierter Diodenlaser
bei 922 nm wird zunächst in seiner Frequenz auf unter 100 Hz
relativ zu einem Referenzresonator stabilisiert. Nach dem
Durchgang durch einen frequenztreuen Trapezverstärker werden danach in
einer ersten Frequenzverdopplung mit Hilfe eines periodisch
gepolten KTP-Kristalls mehr als 200 mW blaues Licht bei 461 nm
erzeugt. Eine zweite Frequenzverdopplung mit BBO führt nachfolgend
zu etwa 1 mW bei 231 nm, der Wellenlänge des 1S0-3P1
Kühlübergangs von In+. Neben der demonstrierten Nutzung im
Indium-Experiment bietet sich dieses System durch seine große
Leistung im blauen Spektralbereich, die weite Durchstimmbarkeit
und die hohe Frequenzstabilität für viele Anwendungen in der
Atomphysik und Quantenoptik an.
Kapitel 6 beschreibt Ergebnisse der Seitenbandkühlung, für deren
Umsetzung Indium ein einzigartiges Modellsystem darstellt. Anhand
einer spektroskopischen Temperaturbestimmung in optisch-optischer
Doppelresonanz wird die praktisch erreichte Grundzustandskühlung
bestätigt. Es ergibt sich eine Temperatur unterhalb von
300 muK, entsprechend einer Amplitude der Säkularbewegung von
unter lambda/10. Durch die zusätzliche Kontrolle der
Mikrobewegung unter lambda/20 sind insgesamt relative
Frequenzverschiebungen des Referenzübergangs aufgrund einer
Bewegung des Ions im Bereich von 10^(-18) zu erwarten. Die
Mikrobewegung besitzt einen starken Einfluss auf die Kühldynamik,
der in einem erweiterten Modell der Seitenbandkühlung
semiklassisch beschrieben wird. Es ergibt sich die verblüffende Situation,
dass eine Kühlung auch für Laserfrequenzen oberhalb der Resonanzfrequenz des
ruhenden Ions möglich ist. Kühlrate und Einfangbereich dieser
Kühlung werden simuliert. Die präzise Kontrolle der zusätzlichen
Mikrobewegung erlaubt eine Prüfung der Vorhersagen im Experiment.
Durch Spektroskopie am Kühlübergang konnte eine effektive Kühlung bei positiver
Laserverstimmung experimentell demonstriert werden. -
In dieser Arbeit betrachten wir spezielle Quantenräume, die für die
Physik eine besondere Bedeutung haben könnten. Zu diesen zählen der
q-deformierte Euklidische Raum mit drei bzw. vier Dimensionen sowie der
q-deformierte Minkowski Raum. Für jeden dieser Räume konstruieren
wir die zur Formulierung physikalischer Theorien wichtigen Elemente einer
q-Analysis, die als eine mehrdimensionale Verallgemeinerung des bekannten
q-Kalküls für q-Funktionen angesehen werden kann. Diese Elemente
ermöglichen in ihrer Gesamtheit ein modulares Konzept, das die Basis zur
Reformulierung bekannter physikalischer Theorien bilden kann und
gleichzeitig deren numerische Auswertung erlaubt. Zu diesem Zweck werden die
nichtkommutativen Quantenräume durch Vereinbarung einer Normalordnung
mit kommutativen Räumen identifiziert. Für diese kommutativen
Räumen berechnen wir das Sternprodukt zweier kommutativer Funktionen,
die Operatordarstellungen für die partiellen Anleitungen des kovarianten
Differentialkalküls und ebenso jene für die Generatoren der
zugehörigen Quantenalgebren. Des Weiteren führen wir einen
Integralbegriff ein, der als Umkehrung der Differentiation aufgefasst werden
kann und daher die Formulierung translations- und rotationsinvarianter
Integrale gestattet. Um Koordinatenfunktionen, die zu verschiedenen
Quantenräume gehören, miteinander multiplizieren bzw. Tensorprodukte
von Quantenräumen bilden zu können, berechnen wir ausserdem
explizite Ausdrücke für das Zopfprodukt. Schliesslich betrachten
wir die untersuchten Quantenräume in Anlehnung an S. Majid als verzopfte
Hopf-Algebren und bestimmen explizite Ausdrücke für das Coprodukt
und die Antipode allgemeiner Koordinatenfunktionen. Auf diese Weise gelangen
wir zu einem mit der Quantengruppensymmetrie verträglichen
Translationsbegriff, der ausserdem zu mehrdimensionalen Versionen der
q-Taylor-Regeln führt. Als Letztes berechnen wir Verallgemeinerungen von
q-Exponentialen, die in einem erweiterten Sinne Eigenfunktionen der
Ableitungsoperatoren darstellen und somit als q-deformierte Versionen ebener
Wellen aufgefasst werden können. -
Die in dieser Arbeit dargelegten Ergebnisse befassen sich mit Experimenten, welche den Mg-In-Ionenfallen-Quantencomputer zum Endziel haben. Als logisches Schaltelement eines solchen Quantencomputers kommen sowohl die Cirac-Zoller- als auch die Sörensen-Mölmer-Version eines CNOT-Gatters in Frage. In beiden
Fällen müssen die Ionen durch Laserstrahlung gekühlt werden. Während das Cirac-Zoller-Gatter Grundzustandskühlung erfordert, wird beim Sörensen-Mölmer-Gatter lediglich der wesentlich einfacher zu erreichende Lamb-Dicke-Bereich
benötigt. Aufgrund der Tatsache, daß zwei verschiedene Ionensorten für unterschiedliche Aufgaben verwendet werden,
kombiniert man deren Vorzüge optimal miteinander. Zur direkten Seitenband-Kühlung verwendet man In, mit dem in unserer Arbeitsgruppe bereits Grundzustandskühlung demonstriert worden ist.
Quanteninformation soll in den Mg-Ionen gespeichert werden. Da beim Sörensen-Mölmer-Gatter, solange man sich im Lamb-Dicke-Bereich befindet, die Quantenrechnung nicht von der thermischen Bewegung der Ionen abhängen,
kann der heterogene Ionenkristall durch die Indiumionen kontinuierlich gekühlt werden, ohne daß die in den Mg-Ionen gespeicherte Quanteninformation dadurch beeinflußt wird. Dadurch kann die Dekohärenz der Schwingungsmoden minimiert, und die Anzahl möglicher Quantenoperationen maximiert werden.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde von Grunde auf ein neues Experiment geplant, aufgebaut und zahlreiche Versuche dazu durchgeführt. Es wurde ein völlig neuer, komplexer Vakuumrezipient entworfen und gebaut. Im Inneren des Vakuumrezipienten wurde ein schwingungsgedämpfter Aufbau einer neuartigen, selbstjustierenden Ionenfallenhalterung inklusive verbesserter Atomofenhalterung in ein kompaktes Gesamtsystem integriert. Die Falle wurde für die Speicherung zweier Ionensorten optimiert.
Mit der linearen Endkappenfalle wurden zuerst Mg-Ionenkristalle erzeugt. Bei den Experimenten mit Indium konnten Mg-In-Wolken nachgewiesen werden, sowie sympathetische Kühlung von Indium durch die direkt lasergekühlten Magnesiumionen.
In der neuen Vierstabfalle wurden zuerst Experimente mit einem Sekundärelektronen-Vervielfacher bei Kühlung mit Puffergas durchgeführt, wobei Speicherung von Magnesiumionen sowie von Dunkelionen aus dem Restgas nachgewiesen werden konnte. Bei diesen Messungen wurde gleichzeitig die Falle charakterisiert. Es wurden Stabilitätsdiagramm, radiale und axiale Schwingungsfrequenzen gemessen.
Darüber hinaus wurden in der neuen Ionenfalle Magnesium-Ionenkristalle gespeichert und nachgewiesen. Die im Vergleich zur linearen Endkappenfalle wesentlich verbesserte Mikrobewegungskompensation demonstriert die Überlegenheit der automatischen Justage der neuen Ionenfalle. -
Die biologisch funktionale Struktur und Dynamik globulärer Proteine entfaltet sich in ihrer nativen Umgebung, die aus ionenhaltigem Wasser besteht. Die entscheidenden Wechselwirkungen sind dabei elektrostatischer Natur. Bei Molekulardynamik-(MD-)Simulationen von Protein-Lösungsmittel-Systemen müssen diese Wechselwirkungen daher genau erfasst und, wegen der Größe der behandelten Systeme, numerisch effizient berechnet werden. Es bietet sich dazu an, das üblicherweise betrachtete mikroskopische Ensemble der Lösungsmittelatome durch ein Lösungsmittelkontinuum zu ersetzen, welches die auf das Protein ausgeübten Reaktionsfeldkräfte erzeugt.
Die Entwicklung einer atombasierten Kontinuumsmethode, mit der sich Reaktionsfeldkräfte und -energien bei solchen MD-Simulationen effizient und genau berechnen lassen, war das Hauptziel der vorliegenden Arbeit. Die Methode wird zunächst für Proteine in rein dielektrischen Lösungsmittelkontinua hergeleitet [B. Egwolf und P. Tavan, J. Chem. Phys. 118, 2039-2056 (2003)] und anschließend um Ionenkontinua erweitert [B. Egwolf und P. Tavan, J. Chem. Phys. 120, 2056-2068 (2004)], welche der linearisierten Poisson-Boltzmann-Gleichung gehorchen. Die zugrundeliegende Theorie wird so weit wie möglich in exakter Form vorangetrieben. Sie führt in natürlicher Weise zu einigen wenigen Näherungen, so dass sich das vom Lösungsmittelkontinuum ausgehende Reaktionsfeld in effizienter Weise mittels selbstkonsistent zu bestimmender Ladungen und Dipole darstellen lässt, die an den mikroskopisch beschriebenen Proteinatomen lokalisiert sind. Die Qualität der atombasierten Kontinuumsmethode wird anhand von Vergleichen mit dem auf sphärische Geometrien beschränkten, analytischen Kirkwood-Reaktionsfeld, einer mikroskopischen Protein-Wasser-Simulation und einer Finite-Differenzen-Methode untersucht.
Darüber hinaus wird ein Verfahren für MD-Simulationen von mikroskopisch beschriebenen Protein-Lösungsmittel-Systemen mit periodischen Randbedingungen vorgestellt [G. Mathias, B. Egwolf, M. Nonella und P. Tavan, J. Chem. Phys. 118, 10847-10860 (2003)]. Dabei werden die Coulomb-Wechselwirkungen zwischen den Atomen mit Hilfe der effizienten, linear skalierenden und strukturadaptierten Multipolmethode (SAMM) bis zu einem Grenzabstand explizit berechnet und für größere Abstände durch das Kirkwood-Reaktionsfeld modelliert. Durch dieses Vorgehen können die von den Randbedingungen erzeugten Periodizitätsartefakte weitgehend unterdrückt werden. Ferner kann das Kirkwood-Reaktionsfeld im Rahmen des SAMM-Ansatzes unter vernachlässigbarem Aufwand berechnet werden. -
Feldtheorien auf nichtkommutativen (NC) Raeumen werden untersucht als realistische Erweiterungen des Standardmodells der Elementarteilchenphysik. Vor allem werden zwei Modelle mit nicht vertauschenden operatorwertigen
Koordinaten betrachtet: Kanonisch NC Raeume und der
kappa-deformierte Raum. Diese NC Raeume werden auf gewoehnlichen
Funktionen durch Sternprodukte dargestellt.
Die deformierte Multiplikation erzwingt, dass in einer
Eichtheorie auf einem NC Raum das Eichpotential nicht Werte in einer Lie Algebra annimmt, sondern in deren Einhuellenden Algebra. Diese NC
Eichtheorie kann jedoch so formuliert werden, dass die
Freiheitsgrade mit denen der kommutativen Eichtheorie
uebereinstimmen. Somit kann die Eichtheorie auf der Basis jeder
Lie Algebra definiert werden, sie wird rein algebraisch aus einem Konsistenzprinzip konstruiert und hier aufgefaechert in der Einhuellenden Algebra zur zweiten Ordnung in theta berechnet. Der Zusammenhang mit der
Seiberg-Witten-Abbildung der Stringtheorie wird ausfuehrlich
diskutiert, ebenso Auswirkungen der Freiheiten dieser Konstruktion fuer physikalische Theorien. Dieser Ansatz der Auffaecherung in theta versteht sich als effektive Theorie. Daher wird die
Quantenfeldtheorie des Standardmodells zwar nicht
im Ultravioletten abgeschirmt, das in der NC Feldtheorie
notorische UV-IR Problem wird aber a priori umgangen.
Der kappa-deformierte Raum ist ein NC Raum mit einer deformierten
Symmetriestruktur. Diese Symmetrie wird durch eine Hopfalgebra
beschrieben und deren Eigenschaften werden hier aus der Konsistenz mit
den NC Vertauschungsbeziehungen hergeleitet. Ableitungs-operatoren werden ausschoepfend diskutiert, ebenso algebraische Vektorfelder und zwei verschiedene Definitionen von Differentialformen. Neu ist die Einf"uhrung eines NC Differentialkalkuels mit genau n Einsformen in
n Dimensionen. Alle abstrakt definierten Groessen werden auf
gewoehnlichen Funktionen durch ableitungswertige Operatoren
dargestellt. Es werden Fortschritte erzielt bei der
Definition eines eichinvarianten Integrals ueber dem kappa-deformierten Raum, das zugleich invariant unter der deformierten Symmetrie ist.
Abschliessend wird die Eichtheorie fuer den kappa-deformierten Raum
konstruiert, aufgefaechert im Deformationsparameter bis zur
zweiten Ordnung. Lagrangefunktionen und Wirkungen werden berechnet. Eichfelder
sind fuer Raeume mit deformierter Symmetrie ableitungswertig und koppeln nicht-trivial mit anderen Feldern. Diese Modelle sagen
keine neuen Teilchen vorher, sondern Wechselwirkungs-Vertices und fuer den kappa-deformierten Fall auch neue Propagatoren. Die explizite Berechnung dieser Theoriefuer das Standardmodell kann zu messbaren Korrekturen fuehren,
z.B. zu im Standardmodell verbotenen Zerfaellen. -
Wasser ist eine hochpolare Flüssigkeit. Ihre ungewöhnlichen elektrostatischen Eigenschaften haben das organische Leben, das sich dort entwickelt hat, geprägt. Daher bestimmen beispielsweise die elektrostatischen Wechselwirkungen zwischen der wässrigen Zellflüssigkeit und den darin gelösten Proteinen, den molekularen Funktionsträgern der Biologie, sowohl die Struktur als auch die Dynamik dieser Makromoleküle. Mikroskopische Simulationsbeschreibungen der in Protein-Lösungsmittel Systemen ablaufenden Prozesse müssen deshalb jene Probleme lösen, welche durch den sehr langsamen 1/r Abfall der Coulomb Wechselwirkung und die endliche Größe von Simulationsmodellen aufgeworfen werden. Die vorliegende Arbeit fasst eine Reihe von Publikationen zusammen, in denen zunächst mit dem sog. SAMM/RF Algorithmus eine genaue und recheneffiziente Lösung für die angesprochenen methodischen Probleme vorgeschlagen und verifiziert wird [G. Mathias, B. Egwolf, M. Nonella, P. Tavan, J. Chem. Phys. 118, 10847-10860 (2003)]. Bei molekularmechanischen (MM) Molekulardynamik (MD) Simulationen ermöglicht dieser Algorithmus die Beschreibung sehr großer Systeme mit mehr als 10^5 Atomen auf einer Nanosekunden-Zeitskala. Für flüssiges Wasser konnten damit winkelaufgelöste Korrelationsfunktionen, die von mir vorgeschlagen wurden, auch bei großen Abständen statistisch genau berechnet werden [G. Mathias, P. Tavan, J. Chem. Phys. 120, 4393-4403 (2004)]. Damit ließ sich die dipolare Struktur der Solvatschalen um ein gegebenes Wassermolekül analysieren. Darüber hinaus wurde nachgewiesen, dass sich Wasser ab Distanzen von etwa 15 A° wie ein homogenes Dielektrikum verhält. Die SAMM/RF Methode wurde ferner zur Beschreibung der langreichweitigen Elektrostatik bei Hybridrechnungen eingesetzt, welche Dichtefunktional Methoden mit MM Kraftfeldern kombinieren, um so Schwingungsspektren biologischer Chromophore in polaren und in komplexen Lösungsmitteln quantitativ genau berechnen zu können. An den Beispielen des Retinalchromophors im Meta-III Zustand des Rhodopsins [R. Vogel, F. Siebert, G. Mathias, P. Tavan, G. Fan, M. Sheves, Biochemistry 42, 9863-9874 (2003)], der Chinone im bakteriellen Reaktionszentrum [M. Nonella, G. Mathias, M. Eichinger, P. Tavan, J. Phys. Chem. B 107, 316-322 (2003)] und eines Chinonmoleküls in wässriger Lösung [M. Nonella, G. Mathias, P. Tavan, J. Phys. Chem. A 107, 8638-8647 (2003)] wird gezeigt, wie elektrostatische Wechselwirkungen eines Moleküls mit seiner Lösungsmittelumgebung seine Schwingungsspektren modifizieren.
-
Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Natur von exotischen Resonanzen im mesonischen Spektrum unterhalb von 2 GeV/c^2 zu untersuchen. Hierzu wurden Antiproton-Neutron Annihilationen gestoppter Antiprotonen, aus der LEAR Anlage des CERN, in einem flüssigen Deuteriumtarget untersucht. Die insgesamt 5,2*10^6 Ereignisse mit einer Driftkammerspur, aufgenommen von dem fast den gesamten Raumwinkel umfassenden Crystal-Barrel Detektor, lieferten nach einer Selektion und einem kinematischen Fit ein praktisch untergrundfreies Datensample mit 144.114 pbar n -> Pi- Pi0 Pi0 Pi0 Ereignissen. Mit Hilfe von Monte-Carlo Simulationen konnte das absolute Verzweigungsverhältnis dieses Kanals zu BR(pbar n -> Pi- Pi0 Pi0 Pi0) = (7,6 +- 0,4)* 10^(-2) bestimmt werden.
Die vollständige Partialwellenanalyse dieses Kanals brachte neben den starken Beiträgen der Rho(770)x(Pi0 Pi0)_S und Rho(770) x f_2(1270) Amplitude, auch eine Rho' x (Pi0 Pi0)_S Amplitude mit einer Masse von 1280 MeV/c^2 für das Rho'. Das aus 4 Pi und K Kbar Zerfällen bekannte Rho'(1450) wurde nicht gesehen. Damit wird die vermutete Aufspaltung in zwei verschiedene Rho' Zustände bestätigt, von denen nur einer als radiale rho-Anregung in das Konstituenten-Quarkmodell paßt.
Klare Evidenzen gibt es auch für (Rho Pi)_x x Pi Amplituden mit Resonanzen x= a_{1,2} und Pi_{0,1,2}. Oberhalb des wohl bekannten a_1(1260) konnten zwei zusätzliche 1^{++} Resonanzen in ihren Zerfällen in die (Rho Pi)-S und -D Welle nachgewiesen werden. Das a_1(1550) kann aufgrund seines starken Zerfalls in die (Rho Pi)-S Welle keine radiale Anregung des a_1(1260) sein, während für das a_1(1850) das charakteristische Verhältnis Gamma(Rho Pi)_D / Gamma(Rho Pi)_S >> 1 einer radialen Anregung des a_1(1260) ermittelt wurde.
Die Identifikation des Pi(1300) als radiale Anregung des Pi Mesons bestätigte sich durch den starken Zerfall in Rho Pi und den kleinen Beitrag in (Pi0 Pi0)_S Pi. Ein weiteres Pi Meson bei 1800 MeV/c^2 wurde erstmalig im Rho Pi und Rho' Pi Zerfall nachgewiesen, jedoch gibt der Vergleich der Partialbreiten in Rho Pi, Rho' Pi und (Pi0 Pi0)_S Pi mit der theoretischen Vorhersage für die zweite radiale Anregung Rätsel auf.
In der (Rho Pi)-P Welle wurde eine exotische Resonanz bei 1450 MeV/c^2 mit den exotischen Quantenzahlen J^{PC} = 1^{-+}, die prinzipiell nicht mit q qbar gebildet werden können, nachgewiesen. Die Evidenz für ein Pi_1 -> Rho Pi bei 1,6 GeV/c^2, welches in anderen Experimenten gesehen wurde, ist dagegen sehr schwach. Es stellt sich die Frage, ob das hier gefundene Pi_1(1450) mit dem exotischen Pi_1(1400) identisch ist, das bisher nur als Eta Pi Resonanz bekannt ist. Ein Vergleich der relativen Pi_1 Produktionsstärken in der atomaren (pbar n) S- und P-Welle zeigt, daß die Rho Pi und Eta Pi Resonanzen verschiedene Zustände sind. -
SHIPTRAP is a new ion trap system for high-precision mass measurements of transuranium recoil-ions from the SHIP facility at GSI. The system consists of a buffer-gas cell to thermalise the incoming ions, an extraction system to separate the ions from the buffer gas, an RFQ buncher to cool and accumulate the ions and a tandem Penning-trap system for isobaric purification and high-precision mass measurements. The buffer-gas cell and the extraction RFQ were developed, assembled and tested within this thesis at the MLL in Garching and at the GSI.
-
Thema der vorliegenden Arbeit ist die Beschreibung von
Ladungstransporteigenschaften molekularer Systeme, wenn diese das
Verbindungsstück zweier Elektroden bilden.
Einen technologischen Meilenstein setzte auf diesem Gebiet die
Rastertunnelmikroskopie, welche ursprünglich für die
Abbildung von Oberflächen mit atomarer Auflösung
entwickelt wurde (Binnig et al., 1981). Heute ermöglicht
sie die gezielte Untersuchung von Transporteigenschaften
einzelner, auf Oberflächen adsorbierter Moleküle.
Parallel dazu hat der immense Fortschritt in der Miniaturisierung
klassischer elektronischer Bauteile in jüngster Zeit
ermöglicht, Zuleitungsstrukturen auf der Nanometerskala zu
bauen, und diese mit einzelnen oder wenigen Molekülen zu
überbrücken (Reed et al., 1997). Es besteht die
Hoffnung, mit solchen Systemen Schaltungselemente zu realisieren,
die heutigen elektronischen Bauteilen in Hinblick auf ihre
Effizienz und den Grad ihrer Miniaturisierung deutlich
überlegen sind.
Experimente mit diesen molekularelektronischen Apparaten werfen
die Frage auf, wie sich die chemische Natur eines Moleküls
sowie seine Kopplung an die Oberfläche der Elektroden auf die
Leitungseigenschaften auswirkt. Eine theoretische Beantwortung
dieser Frage erzwingt eine quantenmechanische Beschreibung des
Systems. Ein genaues Verständnis dieser Zusammenhänge
würde ein gezieltes Entwerfen molekuarelektronischer Bauteile
ermöglichen. Trotz bedeutender experimenteller wie
theoretischer Fortschritte besteht zwischen den Ergebnissen bisher
allerdings nur beschränkt Übereinstimmung.
Diese Arbeit beginnt mit einem Überblick über die
gängigen Methoden zur theoretischen Beschreibung von
Ladungstransport durch molekulare Systeme und charakterisiert sie
hinsichtlich der ihnen zugrundeliegenden Annahmen und
Näherungen. Dabei findet eine Unterteilung in
störungstheoretische sowie streutheoretische Verfahren
statt.
Anschließend werden Methoden der Quantenchemie behandelt, da diese in
nahezu allen Ansätzen zur Beschreibung von elektronischem
Transport durch molekulare Systeme Anwendung finden. Wir
liefern eine Zusammenstellung der wichtigsten
unter den auf diesem Gebiet in immenser Anzahl entwickelten
Methoden und der ihnen zugrundeliegenden Näherungen.
Auf diese allgemeinen Darstellungen folgt eine detaillierte
Beschreibung des numerischen Verfahrens, das im Rahmen dieser
Dissertation zur Berechnung von Stromtransport durch
Molekülstrukturen implementiert worden ist.
Mit der vorliegenden Arbeit wird eine Verallgemeinerung
eingeführt, die eine vormalige Einschränkung der ursprünglichen
Methode bezüglich der betrachtbaren Systeme beseitigt.
Diese so erhaltene Methode wird dann verwendet, um der durch
Experimente von Dupraz et al. (2003) aufgekommenen Frage
nachzugehen, welchen Einfluß die verschiedenen geometrischen
Anordnungen einer Gruppe von identischen Molekülen auf die
Leitfähigkeitseigenschaften eines molekularelektronischen
Apparats ausüben. Unsere Untersuchungen zeigen, daß sich die
Transporteigenschaften nur bei Bildung von Molekülgruppierungen
mit bedeutender intermolekularer Wechselwirkung
wesentlich von denen einzelner Moleküle unterscheiden. Damit
lassen sich Konsequenzen aus der Stabilität von Molekül-Elektroden
Verbindungen für die Reproduzierbarkeit von gewonnenen Meßdaten
ableiten.
Abschließend befassen wir uns mit der Berechnung von
Rastertunnelmikroskop-Bildern. Dabei geben wir zuerst
einen Überblick über bisherige Anwendungen von Modellrechnungen
zur Erklärung experimenteller Daten. Dann präsentieren wir eigene
Berechnungen, die im Rahmen einer Kooperation mit
Constable et al. (2004) dazu beitragen sollen, durch Vergleich
mit deren experimentellen Bildern verschiedene Konformationen
eines auf Graphit adsorbierten Moleküls identifizieren zu können.
Die enorme Größe des Moleküls führt zu Gesamtsystemgrößen, die
eine numerische Durchführung in der Praxis bisher scheitern
ließen. Durch eine neuartige Zerlegung des Eigenwertproblems, das
die praktische Durchführung der von uns verwendeten Methode
bisher verhinderte, sind wir in der Lage, erstmalig Berechnungen
für weitaus größere als die bisher betrachtbaren Systeme
durchzuführen. -
Das Ziel dieser Arbeit war es 40Ca+-Ionen an einen optischen Resonator zu koppeln, um auf diese Weise Resonator-QED-Experimente, mit einer konstanten und
deterministischen Kopplung durchzuf¨uhren. Als wichtigstes Ergebnis ist es erstmals gelungen, im kontinuierlichen Betrieb kontrollierte Lichtpulse zu erzeugen, die genau ein Photon enthalten.
Zun¨achst war es unerl¨asslich, ein bestehendes Experiment weiter zu entwickeln,
so wie wichtige Eigenschaften des 40Ca+-Ions zu vermessen. Dazu wurde die bisherige Falle durch eine verbesserte Ionenfalle ersetzt. Diese wurde charakterisiert, wobei insbesondere eine verbesserte Mikrobewegungskompensation nachgewiesen wurde.
Zur Durchf¨uhrung der hier vorgestellten Experimente, wurde das bestehende Lasersystem weiterentwickelt und ein zus¨atzliches System aufgebaut. Zudem wurde
der optische Resonator und dessen Stabilisierung den Anforderungen der
Resonator-QED-Experimente angepasst.
Um Aufladungen dielektrischer Materialien in der Fallenumgebung zu vermeiden,
wurde die Photoionisation von Kalziumatomen implementiert und die Abh¨angigkeit
der Ladeezienz von den Laserparametern bestimmt. Da aufgrund der reichhaltigen
Niveaustruktur von 40Ca+-Ionen eine Vielzahl von Eekten auftreten,
wurden die spektroskopischen Eigenschaften von 40Ca+-Ionen detailiert vermessen.
Dazu geh¨ort neben den Anregungsspektren die Messung der Lebensdauer des
D5/2 -Niveaus und die genaue Untersuchung des Hanle-Eekts zur Magnetfeld-
Kompensation. Im Rahmen dieser Arbeit wurde zudem die g(2)-Funktion der
Fluoreszenz des Ions studiert. Auch die Ergebnisse dieser Messung spiegeln die
komplexe Niveau-Struktur des Ions wieder. Da die Lokalisierung der Ionen in der Falle von großer Bedeutung ist und diese nur durch Laserk¨uhlung der Ionen in der Falle optimiert werden kann, wurde das Verhalten von 40Ca+-Ionen bei Dopplerk¨uhlung genauer untersucht. Neben dem K¨uhlen der Ionen ist auch die Mikrobewegung des Ions in der Falle f¨ur dessen Lokalisierung von essenziellem Interesse. Kombiniert man einen optischen Resonator mit einer Ionenfalle, so treten aufgrund der Verzerrung des Fallenfeldes Wechselwirkungen zwischen den Spiegeln und den Ionen auf, die zu Mikrobewegung f¨uhren. Dieser Eekt wurde vermessen und mit Simulationen des Fallenfeldes
verglichen.
Um die relative Lage des Ions zur Resonatormode zu bestimmen, wurde ein einzelnes 40Ca+-Ion als nanometrische Probe f¨ur das Resonatorfeld verwendet. Die bisher vorliegenden Daten dieses Experiments wurden im Rahmen dieser Arbeit
erweitert und Eekte der Anregung auf die gemessene Fluoreszenzverteilung untersucht.
Die genannten Messungen und Entwicklungen erm¨oglichten es letztendlich,
Resonator-QED-Eekte nachzuweisen. In dieser Arbeit wurde die stimulierte
Emission mehrerer und eines einzelnen Ions in die Resonatormode beobachtet.
Desweiteren konnte der Einfluss des Resonators auf die Lebensdauer des P1/2 -
Niveau demonstriert werden.
Auf der mit diesem Experiment geschaenen Basis ist es gelungen, eine besonders
interessante Vorhersage der Resonator-QED zu realisieren, die kontrollierte
Erzeugung einzelner Photonen im Dauerbetrieb. Dabei konnte eine Einzel-
Photonenemissions-Wahrscheinlichkeit pro Pumppuls von 8 % erreicht werden.
Diese neuartige Lichtquelle wurde im Rahmen dieser Arbeit sowohl theoretisch
als auch experimentell intensiv untersucht. Die statistischen Eigenschaften der
emittierten Photonen wurden gemessen, und die Erzeugung verschiedener zeitlicher
Pulsprofile konnte demonstriert werden. -
In der vorliegenden Arbeit werden die Weiterentwicklung des experimentellen Aufbaus zur 1S-2S-Zweiphotonenspektroskopie an atomarem Wasserstoff sowie die damit durchgeführten Messungen beschrieben.
Die natürliche Linienbreite des dipolverbotenen 1S-2S-Übergangs ist mit 1,3 Hz sehr gering. Dieser Übergang kann durch Absorption zweier gegenläufiger Photonen bei einer Wellenlänge von 243 nm Doppler-frei angeregt werden. Für eine möglichst hohe Auflösung der Resonanz muß die den Übergang treibende Strahlung eines frequenzverdoppelten Farbstofflasers, dessen Fundamentale nahe 486 nm liegt, spektral schmal und stabil sein. Daher wird der Farbstofflaser auf einen Referenzresonator hoher Finesse stabilisiert.
Der im Rahmen dieser Arbeit neu aufgebaute Referenzresonator wurde weitestgehend von Umwelteinflüssen entkoppelt, so daß die Drift des auf ihn stabilisierten Lasers nun weniger als 1 Hz/s und seine Linienbreite in 2 s weniger als 100 Hz bei 486 nm beträgt. Eine modifizierte Atomstrahlapparatur mit differentiell gepumptem Wechselwirkungsbereich und effizienterer Detektion der 2S-Atome erlaubt nun die Spektroskopie bei niedrigerer Lichtleistung und damit geringerer Verbreiterung des Übergangs durch Ionisation metastabiler Atome. Desweiteren können kältere Atome untersucht werden, deren Spektren kleinere geschwindigkeitsabhängige systematische Effekte aufweisen. Mit diesem Aufbau wurden Spektren einer Breite von nur 500 Hz bei 243 nm aufgenommen, was einer relativen Auflösung von 4x10^-13 entspricht.
Nach Einführung einer differentiellen Meßmethode konnte die Hyperfeinaufspaltung des 2S-Niveaus in atomarem Wasserstoff erstmals mit optischen Methoden bestimmt werden, wobei das Ergebnis von 177 556 860(16) Hz den bisher genauesten Wert für diese Größe darstellt. Ein daraus abgeleiteter Test der QED gebundener Systeme bestätigt die Theorie auf einem Niveau von 1,2x10^-7.
In Zusammenarbeit mit dem Frequenzkamm-Labor wurde die Frequenz des 1S-2S-Übergangs erneut gegen die transportable FOM-Cs-Fontände des BNM-SYRTE, Paris, absolut gemessen und zu 2 466 061 413 187 087(34) Hz bestimmt. Dies entspricht einer verbesserten relativen Auflösung von 1,4x10^-14. Im Vergleich mit dem Ergebnis der vorigen Messung aus dem Jahre 1999 und unter Berücksichtigung der Drift eines Uhrenübergangs in 199-Hg+ kann daraus erstmals eine obere Grenze für die relative Drift der Feinstrukturkonstanten von (-0,9 +- 2,9)x10^-15 pro Jahr abgeleitet werden, ohne daß zusätzliche Annahmen über die Stabilität der anderen Kopplungskonstanten getroffen werden müsssen. Diese Drift ist im Rahmen des Fehlers mit Null verträglich. -
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der experimentellen Analyse atomarer Prozesse in intensiven ultrakurzen Laserpulsen. Der Schwerpunkt liegt hierbei bei den Zwillingseffekten der Erzeugung hoher Harmonischer (``high-order harmonic generation'', HHG) und der Ionisation über Zustände im Kontinuum (``above-threshold ionization'', ATI). Besonders letzterer Effekt wird detailliert in Verbindung mit der Wechselwirkung mit Laserpulsen von nur wenigen Zyklen Länge untersucht. Während es heutzutage Routine ist solche Pulse von weniger als 5 fs zu erzeugen, war die vollständige Kontrolle über das zugrundeliegende elektrische Feld bisher noch nicht möglich. Dies wurde in dieser Arbeit durch die erste eindeutige Messung der den Laserpuls charakterisierenden ``absoluten Phase'' erreicht. Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit dieser Messung erweist sich als hinreichend, um eine neue Methode der aktiven Phasenstabilisierung einzuführen, welche voraussichtlich eine tragende Rolle in zukünftigen phasenstabilisierten Lasersystemen spielen wird. Die beschriebenen Experimente widmen sich zudem auch allgemeinen optischen Effekten, wie beispielsweise der Gouy'schen Phasenanomalie in einem fokussierten Strahl, welche hier erstmals im optischen Bereich und über den gesamten Fokusbereich gemessen wurde. Schliesslich wird gezeigt, wie ATI in Verbindung mit Wenig-Zyklen-Laserpulsen nicht nur als leistungsfähiges Werkzeug zur Phasendiagnostik genutzt werden kann, sondern auch einen neuen Zugang zur Untersuchung der Wechselwirkung von Atomen und Licht mit bis dato unerreichter Zeitauflösung bietet.
- Mostrar mais