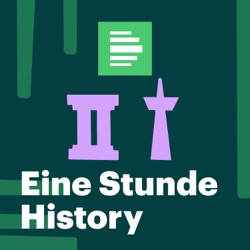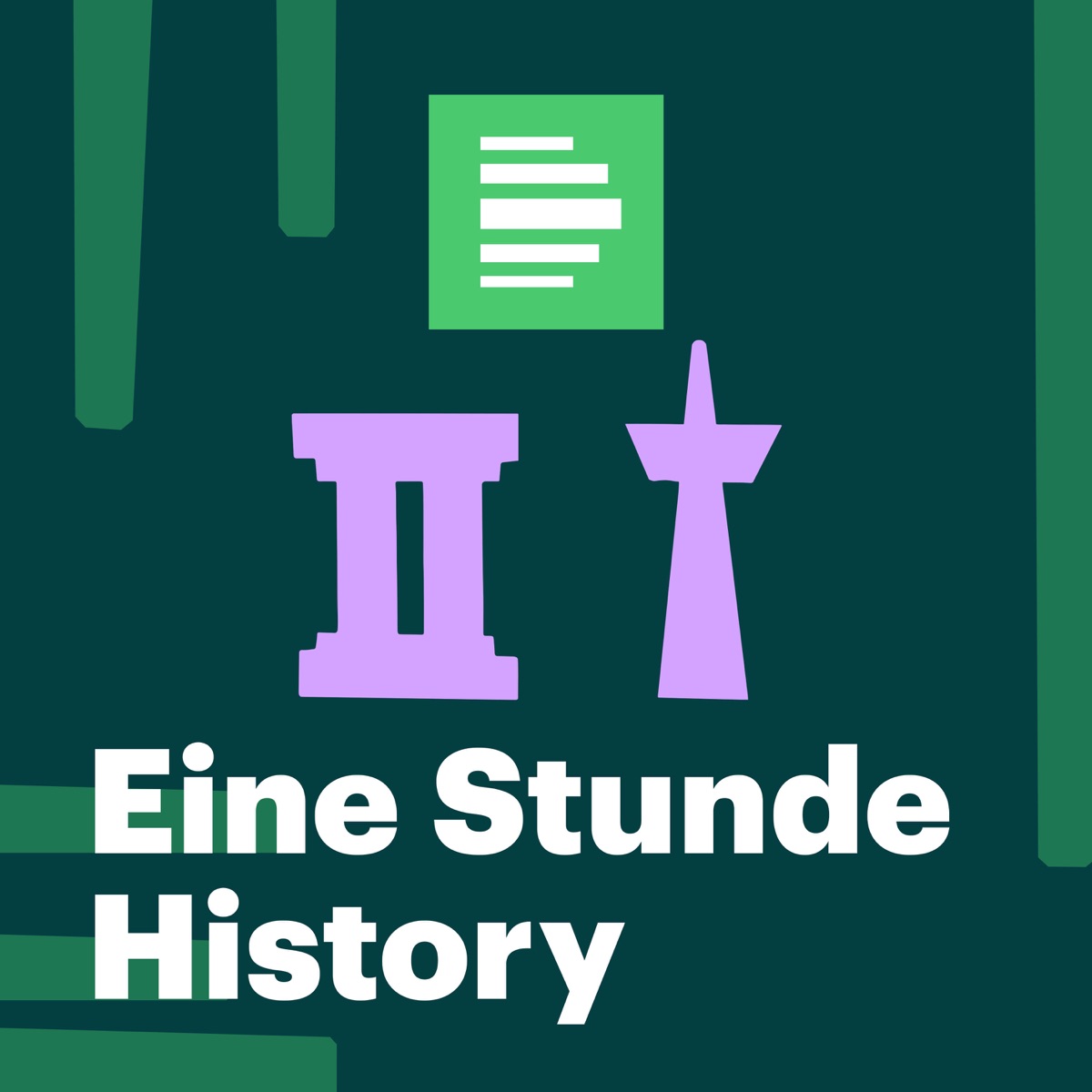Episódios
-
Vor 50 Jahren, im Jahr 1974, erschütterte die Guillaume-Affäre die Bundesrepublik Deutschland. Bundeskanzler Willy Brandt musste im Zug der Enthüllungen zurücktreten. Der DDR-Spion Guillaume hatte es als SPD-Mitglied bis ins Bundeskanzleramt geschafft.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:12:10 - Verfassungsschützer Helmut Müller-Enbergs über den Fall Guillaume
00:25:56 - Historikerin Kristina Meyer über den Rücktritt Willy Brandts
00:39:02 - Historiker Eckard Michels zu den Folgen der Spionage-Affäre
**********
Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:
Eine Stunde History: Grundlagenvertrag von 1972**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Elisabeth ist die Tochter des englischen Königs Heinrich VIII. und Anne Boleyn. Nachdem ihr Vater seine Frau hinrichten lässt, wird Elisabeth für illegitim erklärt. Sie schafft es später dann doch noch auf den Thron und legt als Königin Elisabeth I. den Grundstein für das britische Weltreich.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:10:20 - Der Autor Thomas Kielinger hat eine Biographie über Elisabeth geschrieben und berichtet über wesentliche Daten ihres Lebens.
00:20:04 - Der Historiker Jürgen Klein beschreibt das so genannte "Elisabethanische Zeitalter" mit dem die Regierungszeit Elisabeths I. umschrieben wird.
00:31:18 - Die Hamburger Historikerin Claudia Schnurmann erläutert wie es zum britischen Weltreich kam, das seine ersten Anfänge unter Elisabeth I. nahm.
**********
Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:
Großfürst Iwan III. - Moskau als "Drittes Rom"Dschingis Khan: Das Weltreich der MongolenRömisch-deutscher Kaiser: Die Krönung Karls des Großen**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Estão a faltar episódios?
-
Vor dem Ersten Weltkrieg geht das Deutsche Reich verschiedene Bündnisse ein. Der "Erzfeind" Frankreich bleibt davon ausgeschlossen und schließt daraufhin 1904 ein Abkommen mit Großbritannien ab. Aus der "Entente Cordiale" wird die "Triple Entente", als Russland hinzukommt. Deutschland fühlt sich dadurch umzingelt und rüstet auf.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:13:03 - Historiker Jörn Leonhard
00:23:40 - Historiker Eckhart Conze
00:33:42 - Historiker Rainer F. Schmidt
**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Die Nato, also der Nordatlantikpakt, ist ein Verteidigungsbündnis, zu dem aktuell 32 Länder gehören. Jüngstes Mitglied ist Schweden. Vor 75 Jahren, am 4. April 1949, wurde die Nato gegründet.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:11:01 - Politikwissenschaftler Falk Ostermann über die Gründung der Nato
00:21:48 - Sicherheitsexperte Frank Umbach zum Warschauer Pakt
00:34:04 - Politikwissenschaftler Gunther Hauser zu künftigen Herausforderungen des Bündnisses
**********
Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:
Nato-Norderweiterung: Weg frei für Schweden und Finnland**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Es gibt kaum eine Frau in der Geschichte Skandinaviens, die mehr Einfluss und Macht hatte als Margarethe I. 1375 tritt sie ins Rampenlicht, nachdem ihr Vater König Waldemar IV. im Alter von 55 Jahren stirbt.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:10:27 - Der Historiker Oliver Auge beschreibt die Persönlichkeit von Margarethe I. als mächtige Herrscherin über drei Königreiche in Skandinavien.
00:19:47 - Der Historiker Robert Bohn beschäftig sich mit der Kalmarer Union, die in Konkurrenz zur Handelsorganisation der Hanse stand.
00:30:12 - Der Historiker Martin Krieger ordnet die Bedeutung Margarethes I. in der skandinavischen und europäischen Geschichte ein.
**********
Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:
Bedeutende Herrscherinnen: Queen Victoria als Namensgeberin des Victorianischen ZeitaltersRömisch-deutsches Kaiserreich: Die Krönung von Otto I.Schlacht bei Hastings: Harald II. gegen Wilhelm der Eroberer**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Die Schaffung eines Bürgerlichen Gesetzbuchs, das die persönlichen Freiheiten, die Gleichheit vor dem Gesetz sowie die Trennung von Kirche und Staat festschreibt, ist eine der wesentlichen Forderungen der Französischen Revolution von 1789. Umgesetzt hat sie Napoleon I.
**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Diktator Adolf Hitler will ein billiges Auto für die Massen und Ferdinand Porsche liefert. Sehr klein und wirklich sehr günstig ist das gewünschte Fahrzeug. Gebaut wird in Wolfsburg aber dann zunächst schweres Gerät für den Krieg.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:11:11 - Wirtschaftshistoriker Christopher Kopper erläutert die Bedeutung eines Massenkleinwagens für die Nationalsozialisten.
00:20:01 - Sozialhistoriker Manfred Grieger über die Geschichte des VW-Konzerns während der Zeit des Nationalsozialismus.
00:31:01 - Verkehrswissenschaftler Oliver Schwedes über die Position des VW-Konzerns in Zeiten der E-Mobilität.
**********
Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:
Mobilität: 1888 bekommt Carl Benz den ersten FührerscheinWeltwirtschaftskrise 1929: Der schwarze Donnerstag**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Kyros II. regierte Persien ab etwa 599 v. Chr. Seine Herrschaft gilt als vorbildhaftes Beispiel für Toleranz gegenüber anderen Lebensweisen und Religionen. Der berühmte Kyros-Zylinder, den viele als eine erste Dokumentation von Menschenrechten betrachten, ist heute im British Museum ausgestellt.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:12:03 - Althistoriker Julian Degen über Kyros II.
00:22:11 - Altertumswissenschaftlerin Doris Prechel zur Inschrift des Kyros-Zylinders
00:35:13 - Historiker Heiner Bielefeldt mit Erläuterungen zur Entwicklung der Menschenrechte
**********
Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:
Alexander der Große: Das griechische WeltreichKochexperiment: Das älteste Rezept der Welt**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Der amtierende türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan kam am 26.2.1954 in Istanbul zur Welt – eine unruhige Zeit für die Türkei. Nur ein Jahr später sollten Pogrome gegen die christlich-griechische Minderheit das Land erschüttern.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:11:37 - Die Journalistin und Biographin Cigdem Akyol blickt zurück auf das Leben des Recep Tayyip Erdogan.
00:06:39 - Deutschlandfunk-Nova-Reporter Matthis Jungblut beschreibt den gescheiterten Putschversuch gegen Erdogan im Mai 2016.
00:24:51 - Der Politologe und Türkeiexperte Burak Copur ordnet die politische Bedeutung der Türkei unter Erdogan ein.
00:36:14 - Der ARD-Korrespondent in Istanbul ordnet die außenpolitischen Ambitionen Erdogans im Nahen Osten und bei anderen internationalen Konflikten ein.
**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Rhein, Mosel, Donau sind im Frühjahr 1784 meterdick zugefroren. Im Februar bricht das Wasser unter der Eisschicht gewaltsam hervor. Es verwüstet Dörfer und Landschaften. Die Ursache für die Katastrophe ist zeitlich und räumlich weit, weit entfernt.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
10:20 - Manfred Spata erläutert Ursachen und Ausmaß des Rheinhochwassers von 1784
20:55 - Eva Wodarz-Eichner ist Kennerin des Rheins und der Sagen, die über ihn verfasst worden sind
33:30 - Elke Heidenreich hat den Rhein von der Quelle bis zur Mündung bereist und schildert ihre Eindrücke vom Leben am Rhein
41:38 - Ulrich Cimolino erläutert moderne Schutzmaßnahmen gegen Hochwasser
**********
Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:
Eine Stunde History: Die Weihnachtsflut von 1717Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79: Pompeji wird unter Lava begraben**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Als am 15. Februar 1989 die Sowjet-Truppen aus Afghanistan abziehen, hinterlassen sie ein militärisches Desaster: zwei Millionen getötete Zivilisten, zehn Millionen Geflüchtete.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:11:47 - Tanja Penter erläutert das sowjetische Desaster "Sovietnam".
00:22:16 - Sabine Adler beschreibt die Auswirkungen der Invasion in Afghanistan auf die Sowjetunion.
00:35:50 - Antonia Rados beschreibt die Lage im Land am Hindukusch.
**********
Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:
Afghanistan: Dauerhafter Krisenherd am HindukuschAfghanistan: Die Gründung der Republik 1973Eine Stunde History: Vietnam-Krieg und Agent OrangeVietnamkrieg: Massaker von My LaiTruman Doktrin: Startschuss zum Kalten Krieg**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Facebook ist die Mutter aller Sozialen Netzwerke, mit heute immer noch rund drei Milliarden Nutzenden. Im Februar 2004 begann die Erfolgsgeschichte. Wir blicken zurück auf die Anfänge von Social Media – und was daraus wurde.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:09:27 - Sozialwissenschaftler Jan-Felix Schrape über die Facebook-Gründungsphase
00:19:00 - Journalist Sascha Adamek zur Kritik an Facebook
00:31:29 - Psychologin Sarah Diefenbach zu Nutzen und Gefahren Sozialer Netzwerke
**********
Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:
Facebook und Insta: Aboversion kommt ohne WerbungKurznachrichtendienst: Threads startet in EuropaErfolgsstory: Google wird 25 Jahre alt**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Am 28. Januar 814 herrscht im Fränkischen Reich große Trauer: Der erste römisch-deutsche Kaiser Karl (747-814) stirbt an diesem Tag. Er hinterlässt einen riesigen und vor allem mächtigen Staat.
**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Die "Großmutter Europas" stand knapp 64 Jahre lang an der Spitze des britischen Empires. Ins nach ihr benannte Victorianische Zeitalter fiel ein großer Aufschwung der britischen Wirtschaft – und eine große Ausdehnung der britischen Kolonien.
**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Er war Revolutionsführer, Gründer der Sowjetunion und verfolgte seine Gegner mit brutaler Härte: Bei seinem Tod mit nur 53 Jahren hinterließ Lenin ein machtpolitisches Vakuum. Sein Nachfolger wurde – gegen Lenins Willen – Stalin.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:09:46 - Biograf Hannes Leidinger zu Lenins Person
00:21:32 - Historiker Martin Aust über Lenins Rolle bei der Oktoberrevolution
00:33:56 - Historikerin Susanne Schattenberg zum politischen Erbe der Sowjetunion
**********
Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:
Eine Stunde History: 100 Jahre OktoberrevolutionJosef Stalin: Vom Kriminellen zum sowjetischen Diktator**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Was haben der Göttervater Odin und der Donnergott Thor mit den Gräbern Walhallas gemeinsam? Die Erzählungen über sie entstammen der "Edda". Fast alle germanische Göttersagen haben ihren Ursprung in den beiden Werken.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:09:10 - Germanist und Skandinavist Rudolf Simek
00:18:41 - Kulturwissenschaftlerin Kathrin Chlench-Priber
00:30:37 - Matthias Toplak, der Direktor des Wikinger-Museums Haithabu
**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Eigentlich wollte Elisabeth Maggie Philipps mit "The Landlord's Game" erreichen, dass die Menschen die schlimmen Folgen des Kapitalismus verstehen. Heute heißt das Spiel "Monopoly" – und kommt eher als Übungseinheit für künftige Immobilien-Mogule daher.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:11:00 - Spieleexperte Chris Melzer über die Ursprünge des Spiels
00:19:46 - Jörg Bewersdorff über den Einfluss der Mathematik auf Spiele wie Monopoly
00:33:33 - Ulrich Schädler über die Anfänge des Spielens in der menschlichen Entwicklungsgeschichte
**********
Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:
DDR-Spiele bis Spieltheorie: Wer feiern kann, kann auch spielen**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Humor ist, wenn man trotzdem lacht. "Die Insulaner", angeführt von Günter Neumann, machen sich von 1948 an über die Isolation Berlins lustig. 1961 ist es mit dem Spaß dann vorbei.
**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Ob der Petersdom in Rom wirklich über dem historischen Grab des Simon Petrus steht, bleibt auch nach Jahrhunderten noch ein Rätsel. Die katholische Kirche jedenfalls glaubt fest, dass der erste Papst einst dort bestattet war.
**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
In der DDR war fast jedes Schulkind bei den "Jungen Pionieren", einer Massenorganisation für Kinder. Sie sollte sicher stellen, dass die Jugend im Sinne der DDR-Führung erzogen wird.
**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
- Mostrar mais