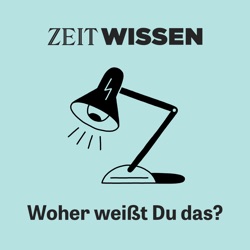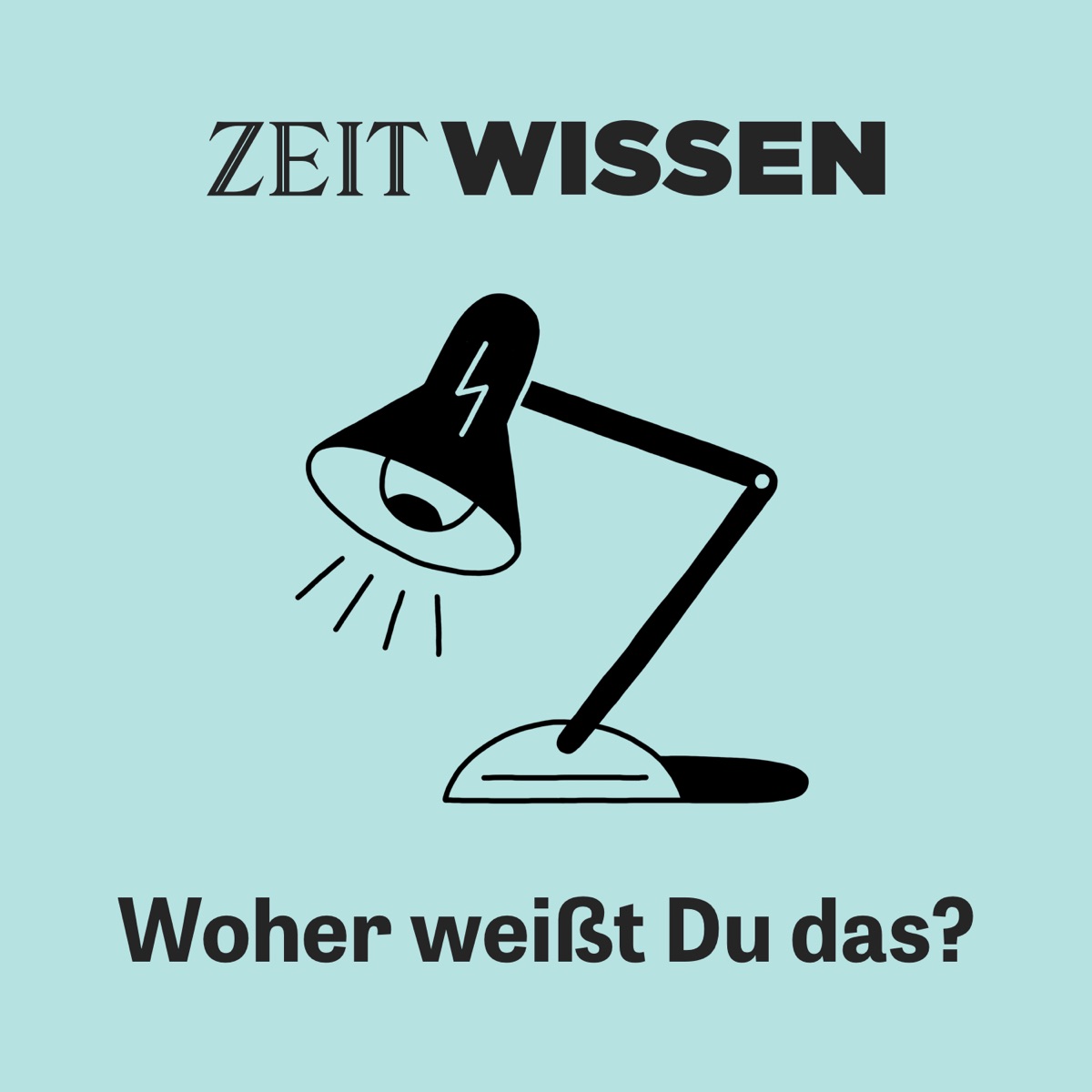Episodit
-
Baden im kalten Fluss, übernachten im Wald oder einfach nur auf dem
Balkon oder im Garten – das sind Mikroabenteuer. Wer sich darauf
einlässt, wird belohnt. Das zeigt die Forschung, und das berichten
Christo Foerster und Johanna Hombergs aus Erfahrung. Im ZEIT
WISSEN-Podcast geben sie Tipps, wie wir schnell und einfach aus dem
Alltag ausbrechen können. Hombergs kann Dachsspuren erkennen und
Unterschlüpfe im Wald bauen, Foerster hat die Mikroabenteuer in
Deutschland populär gemacht. Wie man durch kleine Abenteuer den
Flow-Zustand erreicht, erklärt der Hirnforscher Surjo Soekadar von der
Charité in Berlin. Und Christoph Drösser geht in seiner unmöglichen
Kolumne der Frage nach, warum Teenager risikofreudiger sind als Menschen
in anderen Altersgruppen.
Eine kostenlose Probeausgabe des ZEIT WISSEN Magazins erhalten Sie unter
zeit.de/wissen-podcast.
Wir freuen uns über Feedback und Ideen! Schreiben Sie an
[email protected].
(00:00) Intro
(02:07) Mikro- und Makroabenteuer
(09:20) Im Wald überleben
(13:37) Kinder und Abenteuer
(16:41) Der erste Schritt
(18:28) Wie wir durch Abenteuer wachsen
(21:55) Warum Teenager das Risiko suchen
(26:17) Tipps für Mikroabenteuer
Shownotes
Das neue Buch von Christo Foerster heißt Am besten draußen und ist bei
Malik erschienen. Seine Webseite findet ihr hier, seinen Podcast hier.
Die Webseite der Survivalschule von Johanna Hombergs ist
schattenwolf-wildnisschule.de.
Die Fachartikel von Surjo Soekadar sind bei Google Scholar zu finden.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Sie funkeln hell, sie kosten viel und der Mensch will sie unbedingt
besitzen. Doch damit er an Diamanten kommt, braucht es eine gewaltige
Explosion aus dem Inneren unseres Planeten.
Wo Diamanten ihren Ursprung haben und warum sie so besonders sind,
darüber spricht Podcast-Host Linda Fischer in dieser Episode mit
Geologin und ZEIT-ONLINE-Wissensredakteurin Claudia Vallentin.
In seiner Kolumne schaut Christoph Drösser auf eine ganz besondere Art
von Diamanten, die Carbonados. Denn woher sie kommen, ist seit Langem
ein Rätsel. Sind sie vielleicht das Resultat eines außerirdischen
Besuches?
Wir freuen uns über Feedback und Ideen an [email protected]. Alle
Folgen des ZEIT-Wissen-Podcasts sind auf dieser Seite gesammelt.
(00:00) Intro
(02:20) Nein, Superman könnte keine Diamanten herstellen
(04:16) Die richtigen Bedingungen, damit Diamanten entstehen können
(08:43) Wie der Mensch an Diamanten kommt
(16:27) Warum Menschen so fasziniert von Diamanten sind
(22:02) Blutdiamanten
(26:50) Die unmögliche Kolumne: Woher kommen die schwarzen Diamanten?
Shownotes:
- Als Forscherinnen und Forscher vermuteten, dass es auf Uranus oder
Neptun Diamanten regnen könnte.
- Die Studie dazu im Fachjournal Science Advances (He et al., 2022)
- Einspieler aus dem Superman-Film:
https://www.youtube.com/watch?v=JyHFPV-j8Gs
- Studie über Zusammenhang von Kimberlit-Explosionen und Riftung
(Nature: Gernon et al., 2023)
- Studie zu roten Diamanten aus Australien: (Nature Communications:
Olierook et al., 2023)
- Ausschnitt aus dem Film Blood Diamond:
https://www.youtube.com/watch?v=bOA-ZEf90pI
- Bling-Bling aus der Tiefe – ein Text von Claudia Vallentin über
Diamanten auf ZEIT ONLINE
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Puuttuva jakso?
-
Nachts verwandelt sich der Mensch. Sorgen erscheinen nachts größer als
tagsüber, Gefühle intensiver, Fantasien fantastischer. Es gibt berühmte
Nachteulen wie Madonna und Schiller, die nachts besonders kreativ waren
oder sind. Die Wissenschaft hat einen Verdacht, welche Mechanismen dafür
verantwortlich sind – und wie man sie beeinflussen kann. Im
ZEIT-WISSEN-Podcast erklären Forschende, Reporterinnen und Künstlerinnen
die Nachtseite des Menschen.
Außerdem geht Christoph Drösser der Frage nach, warum die Mehrzahl der
Erwachsenen beim Einschlafen zuckt.
Eine kostenlose Probeausgabe des ZEIT-WISSEN-Magazins erhalten Sie unter
zeit.de/wissen-podcast.
Wir freuen uns über Feedback und Ideen an [email protected]
(00:00) Intro
(02:23) Die Künstlerin der Nacht
(05:01) Das Gehirn nach Mitternacht
(07:17) Berühmte Nachteulen
(09:12) Nächtliche Grübelschleifen
(12:23) Das Melatonin-Rätsel
(14:42) Sich die Nacht zunutze machen
(18:03) Schlafstörungen
(20:42) Einschlafzuckungen
(24:44) Ausblick
Shownotes:
Über die "Mind-after-Midnight-"Hypothese schreibt Max Rauner in diesem
ZEIT-WISSEN-Artikel.
Der Fachartikel von Andrew Tubbs über die
"Mind-after-Midnight"-Hypothese ist hier zu finden.
Der erste Teil der ZEIT-WISSEN-Serie über die Nacht ist hier
nachzulesen.
Der Schlafforscher Jürgen Zulley schreibt über seine Experimente und
Forschung auf seiner privaten Website.
Das Buch "Sleepless" von Annabel Abbs ist unter anderem bei Thalia
erhältlich.
Auszüge aus dem Gespräch des "Rolling Stone"-Magazins mit Madonna und
Maluma sind auf YouTube zu sehen.
Die Website der Künstlerin Silke Silkeborg: silke-silkeborg.de
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Die Eingeweide und das Gehirn raus, dann trocknen, einbalsamieren und
einwickeln: Die alten Ägypter wussten, wie man einen toten Körper fit
macht für die Ewigkeit. Dafür interessieren sich damals wie heute nicht
nur Forschende, sondern auch Abenteurerinnen, Abergläubische und
Grabräuber.
In den vergangenen Jahrhunderten brachten reiche Reisende Mumien im
Gepäck von Ägypten nach Europa. Vor welche Schwierigkeiten das
Archäologen heute stellt und warum sich der europäische Adel im 19.
Jahrhundert zur Mumienparty traf, darüber sprechen Podcasthost Maria
Mast und ZEIT-ONLINE-Wissensredakteurin Viola Kiel im neuen
Wissenspodcast Woher weißt Du das?
Außerdem beschäftigt sich Christoph Drösser in seiner unmöglichen
Kolumne mit der Frage, wie es vor Jahrtausenden bereits möglich war,
tonnenschwere Steinblöcke zu Pyramiden aufzustapeln. Fest steht
jedenfalls, dass die alten Ägypter die 146 Meter hohe Cheopspyramide
ohne elektrischen Kran gebaut haben.
Wie oft denken Sie ans alte Ägypten? Schreiben Sie es uns. Wir freuen
uns auch über Kritik, Lob und Themenwünsche an [email protected].
Eine kostenlose Probeausgabe des ZEIT-Wissensmagazins erhalten Sie unter
zeit.de/wissen-podcast.
Alle Folgen und Quellen des ZEIT-Wissenspodcasts sind auf dieser Seite
gesammelt.
(00:00) Intro
(02:09) Die Mumienmanie des 19. Jahrhunderts
(06:34) Enttäuschung auf der Mumienparty
(08:30) Die Heilkräfte zermahlender Mumien
(11:27) Was Wissenschaftler heute an Mumien erforschen
(16:54) Kolumne: Das Rätsel um den Pyramidenbau
(falls am Anfang Werbung geschaltet ist, verschieben sich die Kapitel um
ca. 45 Sekunden)
Shownotes
- Viola Kiel schreibt auf ZEIT ONLINE über die Mumienmanie des 19.
Jahrhunderts.
- Mehr zu den Mumienfunden in der Jenaer Sammlung lesen Sie hier oder
hier: Paust et al., 2023.
- Wie tonnenschwere Steinblöcke zum Pyramidenbau transportiert wurden:
PNAS: Sheisha et al., 2020.
- Dieses Video zeigt eine Theorie zum Bau der Pyramiden.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Pupsen ist normal. Wir alle tun es. Aber die wenigsten reden darüber.
Wer beim Pupsen ertappt wird, schämt sich. Warum eigentlich? Das
erklären eine Anthropologin und eine Psychologin im ZEIT WISSEN-Podcast.
Der Gastroenterologe Martin Storr spricht über medizinische Aspekte: Wie
viel pupsen ist normal? Welche Lebensmittel verursachen den meisten
Gestank? Und warum pupst man im Flugzeug mehr als gewöhnlich? Fun Fact:
Pupsen wird auch als Protestform genutzt.
Außerdem erzählt Hella Kemper von Tieren, die mit ihren Pupsen
kommunizieren oder sich damit verteidigen. Und Christoph Drösser
erkundet in seiner unmöglichen Kolumne die mysteriöse Verbindung von
Darm und Gehirn.
Eine kostenlose Probeausgabe des ZEIT WISSEN Magazins erhalten Sie unter
zeit.de/wissen-podcast
Wir freuen uns über Feedback und Ideen an [email protected].
(00:00) Intro
(02:59) Was sind Pupse und woher kommt das Geräusch?
(05:07) Wie viel pupsen ist normal?
(08:24) Warum sind Pupse so faszinierend?
(09:27) Pupsende Prominente
(12:41) Pups-Scham
(16:41) Pupsen als Protestform
(18:10) Pupsende Tiere
(23:50) Die Verbindung vom Darm zum Hirn
(falls am Anfang Werbung geschaltet ist, verschieben sich die Kapitel um
ca. 45 Sekunden)
Shownotes
Kirsten Bell schreibt über die Anthropologie des Alltags in ihrem Buch
"Silent but Deadly".
Martin Storr hat ein Buch über die sogenannte FODMAP-Diät
veröffentlicht: eine medizinische Ernährung, die bei übermäßiger
Gasbildung helfen könnte.
Don Corrigan schreibt über Pupsen in der Popkultur in seinem Buch "I
fart in your general direction!”
Mr. Methane pupst in einer norwegischen Talkshow.
Eine Schallplatte des Kunstfurzers Joseph Pujol wird auf Youtube
abgespielt.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Treibhausgase erwärmen die Erde, das ist bekannt. Doch die wärmsten
Jahre in der Geschichte waren häufig Jahre, in denen das "Jesuskind" die
Erde heimsuchte: El Niño, so tauften peruanische Fischer ein
Wetterphänomen, das alle paar Jahre die Fische an ihrer Küste vertreibt
und am anderen Ende der Welt für Fluten oder Dürre sorgt.
Wie all das zusammenhängt und warum dieses Wetterphänomen und sein
Gegenstück La Niña eine Menge Geld kosten, darüber sprechen Podcasthost
Linda Fischer und ZEIT-ONLINE-Wissensredakteurin Claudia Vallentin im
neuen Wissenspodcast Woher weißt du das?.
Außerdem beschäftigt sich Christoph Drösser in seiner Kolumne mit der
paradox erscheinenden Eigenschaft von Wolken, die Atmosphäre sowohl zu
erwärmen als auch zu kühlen. Was wohl mit ihnen im Klimawandel passiert?
**Shownotes: **
- Wie El Niño sich im Verlauf von 2023 langsam im Pazifik aufbaute,
ist in dieser Visualisierung auf ZEIT ONLINE zu sehen.
- Studie in der Fachzeitschrift Science zum Einfluss von El Niño auf
die Weltwirtschaft.
- Wie El Niño im Detail funktioniert – eine Übersicht von
Klimaforscher Mojib Latif.
- Vorhersage der ENSO-Phasen durch die Noaa. Die Wahrscheinlichkeit
für eine neutrale Phase ist seit Podcastaufzeichnung gestiegen und
liegt derzeit bei über 70 Prozent.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Normalerweise tickt unsere innere Uhr synchron mit dem Wechsel von Tag
und Nacht, hell und dunkel. Bei vielen Menschen, die völlig blind sind,
ist diese Synchronisation gestört, aber auch bei einigen Sehenden.
Non-24 heißt die Störung. Die Betroffenen sind phasenweise völlig
übernächtigt, haben Probleme, pünktlich zur Arbeit zu erscheinen oder
bei einem Date, sie leben dann wie in einer anderen Zeitzone. Einer von
ihnen ist der 34-jährige Stephen Larroque. In dieser Episode erzählt er
von seinem Alltag mit Non-24.
Außerdem erklärt der Schlafmediziner Ingo Fietze von der Charité in
Berlin, wie sich die innere Uhr im Laufe des Lebens verschiebt und bei
welchen Symptomen man von einer Schlafstörung spricht.
Tobias Hürter gibt Tipps für einen guten Schlaf. Und Christoph Drösser
geht in seiner unmöglichen Kolumne der Frage nach, warum Menschen
schlafwandeln.
(00:00) Intro (03:20) Die Schlafstörung Non-24 (05:40) "Dein Vater ist
ein Vampir" (10:30) Eulen und Lerchen (13:00) Schichtarbeit (15:15)
Schlaftipps von Tobias Hürter (22:45) Warum manche Menschen
schlafwandeln (26:25) Ausblick
Eine kostenlose Probeausgabe des ZEIT WISSEN Magazins erhalten Sie unter
http://www.zeit.de/wissen-podcast
Wir freuen uns über Feedback und Ideen an [email protected].
Shownotes
Stephen Larroque schreibt über sein Leben mit Non-24 und seine
Selbsttherapie-Versuche in diesem Protokoll.
In diesem Fachartikel von Ingo Fietze und anderen geht es um Non-24 und
die Behandlung der Schlaf-Wach-Rhythmusstörung mit einem Schlafmittel.
Die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und
Umweltmedizin behandeln unter anderem die Relevanz der inneren Uhr für
die Schichtarbeit und beschäftigen sich mit der Gestaltung von
Schichtarbeit unter gesundheitlichen Aspekten.
Das Buch von Tobias Hürter heißt: "Du bist, was Du schläfst"
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Es sind beunruhigende Befunde: Weltweit hat die Zahl der Spermien rapide
abgenommen, fanden die Autoren einer Metastudie im vergangenen Jahr.
2018 hatten Männer im Schnitt nur noch halb so viele Spermien im
Ejakulat wie 1973 – zuletzt beschleunigte sich die Abnahme sogar noch.
Droht der Menschheit also die Unfruchtbarkeit?
Dieser Frage ist Tom Kattwinkel, Redakteur im Gesundheitsressort von
ZEIT ONLINE, nachgegangen. Im neuen ZEIT-Wissen-Podcast führt er uns
durch die Studienlage – und was sie für die Männer von heute bedeutet.
Der israelische Epidemiologe Hagai Levine, der die Studie
mitdurchgeführt hat, erklärt, warum er sich sorgt, nicht Großvater
werden zu können. Die Urologie-Professorin Dolores Lamb hingegen
kritisiert die Schlussfolgerungen: Kaum eine Messung in der Medizin sei
so wenig standardisiert wie das Spermiogramm. Keiner wisse, ob die
Spermienzahl wirklich abnehme.
Und in der unmöglichen Kolumne geht Christoph Drösser der Frage nach,
warum immer mehr Männer Erektionsprobleme haben (21:29).
Wir freuen uns über Kritik, Lob und Themenwünsche an
[email protected].
Weitere Links zur Folge:
- Bereits 2021 berichtete Tom Kattwinkel auf ZEIT ONLINE über die
beunruhigenden Spermien-Daten.
- Als im vergangenen Jahr eine neue Metastudie erschien, nahm er das
zum Anlass, sich die Datengrundlage noch einmal kritisch
anzuschauen. Seine Analyse erschien ebenfalls auf ZEIT ONLINE.
- Und auf ihrem Instagram-Account warnt die Epidemiologin Shanna Swan,
die ebenfalls an den Studien beteiligt war, mit teils drastischen
Worten und Vergleichen vor der Abnahme der Fruchtbarkeit.
Anmerkung der Redaktion: Leider ist uns bei der Wiedergabe eines Zitats
von Shanna Swan (07:18 – 07:49) ein Fehler unterlaufen. Swan sagt nicht,
dass Männer in 20 Jahren "eigentlich gar keine Spermien mehr" hätten,
sondern dass – extrapoliere man den bisherigen Verlauf – die Hälfte der
Männer dann eine geschätze Spermienzahl von 0 haben müsste. Wir bitten,
diesen Fehler zu entschuldigen.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Ed Witten wird gerne als Einstein unserer Zeit bezeichnet. Er hat die
Stringtheorie maßgeblich mit entwickelt. Sie soll die beiden großen
Theoriegebäude der Physik – Relativitätstheorie und die Quantentheorie –
miteinander verheiraten und gilt als Kandidat für eine Theorie für
Alles. Das Problem: Die Stringtheorie sagt vorher, dass es nicht nur ein
Universum gibt, sondern eine unvorstellbar große Zahl von
Paralleluniversen, Multiversum genannt. Manche Kosmologen sehen in der
Theorie sogar Hinweise auf Doppelgänger von uns Menschen.
Im Interview mit ZEIT und ZEIT WISSEN erklärt Ed Witten, wie es zu der
Vorhersage der vielen Universen kam und warum er mit dieser Vorstellung
gerungen hat. Außerdem fragen wir ihn nach seiner Einschätzung zur
Existenz von Doppelgängern in anderen Universen. ZEIT-Redakteur Ulrich
Schnabel hat vor Jahren sowohl Ed Witten als auch den 2018 verstorbenen
Stephen Hawking getroffen und erzählt von diesen Begegnungen.
In seiner unmöglichen Kolumne geht Christoph Drösser der Frage nach,
warum in fast allen Gesellschaften Religionen entstanden sind.
Eine kostenlose Probeausgabe des ZEIT WISSEN Magazins erhalten Sie unter
zeit.de/wissen-podcast
Wir freuen uns über Feedback und Ideen an [email protected].
Die folgenden Kapitelmarken verschieben sich um etwa 45 Sekunden, falls
der Podcast Werbung enthält.
(00:00) Intro (01:50) Das Trauma, Ed Witten zu interviewen (05:10) Was
Ed Witten von Stephen Hawking unterscheidet (07:00) Ed Witten als
Einstein unserer Zeit (07:55) Das Multiversum im Hollywood-Film (11:40)
Einsteins Traum (13:00) Stringtheorie für Dummies (15:45) Das Argument
für Paralleluniversen (18:35) Occams Rasiermesser (21:28) Haben wir
Doppelgänger in Parallelwelten? (23:30) So arbeitet Ed Witten (25:20)
Christoph Drösser über den Ursprung von Religionen (29:13) Vorschau
Shownotes Das ZEIT-Interview mit Ed Witten ist hier zu finden.
Ed Witten hat bis zum 29. Juli unter @witten271 getwittert.
Pressemitteilung der Joachim-Herz-Stiftung zur Verleihung des Hamburger
Preises für Theoretische Physik an Ed Witten.
Ulrich Schnabel schreibt über seine Begegnungen mit Ed Witten und
Stephen Hawking in diesem ZEIT-Artikel.
Tobias Hürter schreibt in der ZEIT über die Stringtheorie (2014).
Tobias Hürter und Max Rauner erklären das Multiversum in ihrem Buch Die
verrückte Welt der Paralleluniversen.
Fotos: Roman Pawlowski für Die ZEIT
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Knapp 120 Jahre ist es her, dass Alois Alzheimer eine "eigenartige
Erkrankung der Hirnrinde" beschrieb. Jahre, in denen die Medizin nie ein
Mittel hatte, das gegen die Ursache der nach ihm benannten
Alzheimer-Demenz hilft. Das wird sich nun ändern. Denn in Kürze dürfte
die europäische Arzneimittelbehörde Ema Lecanemab, Handelsname Leqembi,
zur Zulassung empfehlen.
Was ist das für ein Mittel und wem kann es wirklich helfen? Was ist mit
den Hirnblutungen, die viele der Probanden in der Zulassungsstudie
betrafen? Und ist das Mittel vielleicht erst der Anfang einer
Revolution? Darüber spricht Jakob Simmank in diesem Podcast mit Ingo
Arzt, Redakteur im Gesundheitsressort.
Wir freuen uns über Kritik, Lob und Themenwünsche an
[email protected].
Weitere Links zur Folge:
- Einen ZEIT-Titel über die neuen Medikamente aus dem vergangenen Jahr
lesen Sie hier.
- Im ZEIT-ONLINE-Interview erklärt Christian Haass, wieso die neuen
Antikörper ein Durchbruch sind.
- Und hier erfahren Sie, was Demenz-Coaches machen und wieso sie für
die Krankenhausbehandlung von Alzheimer-Kranken so wichtig sind.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
80 Prozent der Deutschen haben irgendwann in ihrem Leben Probleme mit
der Wirbelsäule. Eine regelrechte Rückenschmerzindustrie hält unzählige
Angebote für sie bereit, von Spezialstühlen über Rücken-Check-ups bis
hin zu Operationen. Manches davon ist Geld- und Zeitverschwendung. Im
ZEIT-WISSEN-Podcast erklären Experten, was wirklich hilft – und wann
eine Röntgenaufnahme sinnvoll ist (12:04).
Außerdem besucht ZEIT WISSEN eine Schule für Schlangenmenschen und
fragt, ob auch sie Rückenschmerzen haben und wie sie es schaffen, ihre
Wirbelsäule so extrem zu verbiegen. (08:27)
Plus: Warum haben Menschen in manchen Kulturen keine Rückenschmerzen?
Christoph Drösser geht dieser Frage in seiner unmöglichen Kolumne auf
den Grund. (24:38)
Eine kostenlose Probeausgabe des ZEIT WISSEN Magazins erhalten Sie unter
http://www.zeit.de/wissen-podcast
Wir freuen uns über Feedback und Ideen an [email protected].
(00:00 - 01:59) Intro (02:00 - 03:53) So viele Arbeitnehmer*innen haben
Rückenschmerzen (03:54 - 08:26) Was passiert bei einem BackCheck? (08:27
- 12:03) Haben Schlangenmenschen Rückenschmerzen? (12:04 - 17:29)
Bewegung: Das Wundermittel gegen Rückenschmerzen? (17:30 - 21:36) Der
häufigste Grund für Rückenschmerzen (21:37 - 24:37) Warum Röntgen nicht
immer sinnvoll ist (24:38 - 28:39) Warum haben andere Kulturen weniger
Rückenschmerzen? (28:46 - 29:38) Mehr Wissen
Shownotes
2022 gründete Nicole Gerstner die Schule für Kontorsion Intentional
Movement Acadamy (IMA). Es gibt Kursangebote zu Stretching, Kontorsion,
Akrobatik und Luftartistik.
Die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin (DGS) und der Berufsverband
der Ärzte und Psychologischen Psychotherapeuten hat sich unter anderem
damit beschäftigt, wie viel die Versorgung von Patient*innen mit
Rückenschmerzen und deren Fehlzeiten kostet.
Der BackCheck ermittelt Kraftwerte und erstellt mittels einer Software
einen individuellen Trainingsplan. Wir haben den BackCheck beim
Unternehmen Gesundheit in Bewegung (GiB) getestet.
Dieser Fachartikel von 2008 berichtet über die Untersuchung der Rücken
von fünf Frauen, die in der Zirkusschule der Mongolei (in Ulaanbaatar)
ausgebildet worden sind.
Dieser Artikel von Cochrane fasst Studien zur Einnahme von
Schmerzmitteln und ihren Nebenwirkungen zusammen.
In diesem Artikel von Cochrane geht es um die Frage, welche Art von
Bewegung gegen Rückenschmerzen hilft.
Dieser Artikel der Bertelsmann Stiftung beziffert den Anstieg der
Wirbelsäulen-Operationen in den vergangenen 15 Jahren.
Das "Deutsche Ärzteblatt" beschäftigt sich mit den Ursachen von
Rückenschmerzen.
Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie beschreibt in ihren Leitlinien,
wann Rückenoperationen sinnvoll sind.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Das Risiko an Krebs zu erkranken, Herzinfarkte und andere Erkrankungen
werden stark von einem unaufhaltsamen Faktor beeinflusst: dem
Älterwerden. Wer lange gesund bleiben will, sollte also vor allem
versuchen, diesen Prozess zu bremsen. Aber wie? Glaubt man dem
Harvard-Genetiker und Altersforscher David Sinclair, dann hilft vor
allem eines: seltener zu essen.
In einer neuen Folge des ZEIT-WISSEN-Podcasts klären Jakob Simmank und
Linda Fischer, was hinter dem Intervallfasten-Hype steckt. Kann es
helfen, 16 Stunden am Tag nichts zu essen – also zwischen 20 Uhr abends
und 12 Uhr mittags keine Kalorien zu sich zu nehmen, weder Chips noch
Bier am Abend und nicht einmal Milch in den Kaffee am Morgen?
Jakob Simmank hat mit Morten Scheibye-Knudsen vom Center for Healthy
Aging in Kopenhagen gesprochen, der eine der wenigen klinischen Studien
zum Thema leitet, mit dem Naturheilkundler Andreas Michalsen sowie dem
Altersforscher Valter Longo, die seit Jahrzehnten zum Fasten forschen.
Und in der unmöglichen Kolumne geht Christoph Drösser der Frage nach, ob
Menschen, die moderat Alkohol trinken, wirklich länger leben (14:41).
Shownotes
Ein ZEIT-Dossier zum Thema Intervallfasten lesen Sie [hier](https://www.zeit.de/2023/31/intervallfasten-ernaehrung-gesundheit-alterung-wissen-podcast-2).
Einen ausführlichen Text über die Suche nach der perfekten Diät, erschienen in ZEIT WISSEN, lesen Sie [hier](https://www.zeit.de/zeit-wissen/2023/02/diaet-ernaehrung-abnehmen-wissenschaft).
Was gesunde Ernährung genau ausmacht, erklärt Ernährungswissenschaftler Martin Smollich im [ausführlichen Interview mit ZEIT ONLINE](https://www.zeit.de/gesundheit/zeit-doctor/2023-05/gesunde-ernaehrung-fleisch-verzicht-zucker-salz-krebs-erkrankungen).
Wir freuen uns wie immer über Kritik, Lob und Themenwünsche an
[email protected].
(00:00-02:43) Intro
(02:44-06:36) Was ist Altern überhaupt?
(06:37-09:44) Wie Fasten wirkt
(09:45-12:10) Fasten verjüngt – bisher vor allem Tiere
(12:11-14:40) Wie man das Fasten beim Menschen erforscht
(14:41-18:56) Die unmögliche Kolumnne: Leben moderate Trinker länger?
(18:57-26:01) Frühstück oder nicht: Die beste Art zu fasten
(26:02-26:49) Mehr Wissen
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Rauchen ist tödlich, das wissen alle. Wer lange raucht, stirbt häufig an
Herzinfarkt, Lungenkrebs oder anderen Herz- oder Lungenleiden. Unser
Gesundheitsredakteur Tom Kattwinkel ist einer Theorie nachgegangen, die
unter seinen rauchenden Freunden verbreitet war: Mit 30 aufhören, dann
geht das noch gut.
Ein Blick in Studien hat gezeigt, da ist tatsächlich was dran.
Wer jung ist, raucht häufig nicht mehr, sondern nutzt Vapes oder
Tabakerhitzer. Für solche neueren Produkte gibt es zwar noch nicht die
Langzeitdaten, die so klar den Schaden von normalen Zigaretten zeigen.
Doch für deren Wirkung im Körper haben Mediziner bereits klare Hinweise
gefunden (19:59).
Christoph Drösser fragt sich in seiner Kolumne, warum manche Menschen
eher nikotinabhängig werden als andere (23:13).
Shownotes:
- Mit 30 höre ich auf. Der Text von unserem Gesundheitsredakteur Tom
Kattwinkel auf ZEIT ONLINE.
- Der Tabakatlas, herausgegeben vom Deutschen Krebsforschungszentrum.
- Studie: Raucher haben ein dreifach erhöhtes Sterberisiko.
- Studie: Wer zwischen dem 25. und 35. Geburtstag aufhört, lebt zehn
Jahre länger als langjährige Raucher – zumindest statistisch.
- Studie: Nach einem Rauchstopp nimmt die Zahl der Mutationen im
Erbgut von Lungenzellen ab.
- Vier junge Raucher erzählen, warum sie angefangen haben. Niko Kappel
hat zugehört.
- Studie: Das US-Krebsforschungszentrum NCI trug in einem weltweit
viel beachteten Bericht alle bekannten Beweise für die Wirkung von
Werbung auf das Rauchverhalten zusammen.
Wir freuen uns über Kritik, Lob und Themenwünsche an
[email protected].
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
In der Geschichte von Peter Anema und Erik Hulsegge gibt es viele
Verlierer. Die beiden sind Zwillingsbrüder, wurden aber nach der Geburt
getrennt und zur Adoption freigegeben. Mit 17 begegnen sie einander zum
ersten Mal, mit 33 treffen sie ihre leibliche Mutter. Schuldgefühle,
Trauer und Traumata brechen auf. In dieser Familientragödie gibt es aber
auch eine Gewinnerin: die Wissenschaft.
Forschungsteams studieren an getrennt aufgewachsenen Zwillingen den
Einfluss von Genen auf das menschliche Verhalten. Trotz der vielen
Jahre, die manche eineiigen Zwillinge in getrennten Umwelten gelebt
haben, haben sie oft verblüffende Ähnlichkeiten – bis hin zu
ausgefallenen Marotten. Im @zeitwissen-Gespräch erzählen Erik und Peter,
wie der Zufall sie zusammengeführt hat. Führende Zwillingsforscherinnen
und -forscher erklären, warum selbst eine Eigenschaft wie Religiosität
in den Genen stecken kann – und was Eltern aus den Erkenntnissen für die
Erziehung ihrer Kinder ableiten können.
Plus: In seiner unmöglichen Kolumne fragt Christoph Drösser, warum der
Anteil der Zwillinge in der Bevölkerung von Land zu Land so
unterschiedlich ist (22:45).
Shownotes:
Welchen Anteil haben die Gene, welchen Anteil hat die Umwelt? Seit 1960
haben Zwillingsstudien diese Fragen für rund 18.000
Persönlichkeitsmerkmale und Krankheiten untersucht. Diese interaktive
Website macht die Forschungsergebnisse zugänglich. Es ist hilfreich, das
Erklärvideo anzuschauen.
Nancy Segal hat mehrere populärwissenschaftliche Bücher über ihre
Forschung und über außergewöhnliche Zwillingsschicksale geschrieben. Ein
guter Ausgangspunkt ist ihre Website.
Das Team der University of Minnesota, das mehr als hundert getrennt
aufgewachsener Zwillinge untersucht hat, fasst seine
Forschungsergebnisse unter anderem in diesem Science-Artikel zusammen.
Zu “Was wir nicht erklären können”: Die aktuellste Studie über die Zahl
der Zwillingsgeburten stammt von 2021, sie wurde in der Zeitschrift
Human Reproduction veröffentlicht. Ein interessanter Artikel, wie die
hohe Zwillingsquote die Kultur der Yoruba in Nigeria prägt, erschien
2002 in Twin Research. Die Entdeckung zweier Gene, die die
Wahrscheinlichkeit von Zwillingsgeburten erhöhen, wurde 2016 im American
Journal on Human Genetics vermeldet.
Kennen Sie Zwillinge, die getrennt aufgewachsen sind, oder sind Sie
selbst betroffen? Schreiben Sie an [email protected]
Max Rauner dankt Myrthe Buitenhuis für die Vermittlung des Kontakts zu
Erik und Peter.
Eine kostenlose Probeausgabe des ZEIT WISSEN Magazins erhalten Sie unter
zeit.de/wissen-podcast
Wir freuen uns über Feedback und Ideen an [email protected]
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER
Kapitel
(00:00 - 03:13) Die Mutter weint und weint und weint (03:13 - 06:44)
“Wir waren das Produkt einer außerehelichen Beziehung” (06:44 - 08:49)
Der Zufall führt sie nach 17 Jahren zusammen (08:49 - 12:45) Was macht
die Zwillingsforschung? (12:45 - 19:00) Religiosität steckt in den Genen
(19:00 - 20:55) Aggressivität ist erblich (20:55 - 22:45) Noch ein
Wiedersehen mit der Mutter (22:45 - 26:45) Beeinflusst die Ernährung
Zwillingsgeburten? (26:45 - 28:00) Themen im ZEIT WISSEN Magazin
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
In einer Tongrube im Allgäu entdeckt ein Forschungsteam 21 Knochen, die
von einem Vorfahren des Homo sapiens stammen. Die Forschenden taufen ihn
“Udo”. Sein Körperbau bringt die bisherige Erzählung von der Evolution
des aufrechten Gangs durcheinander. Mithilfe von Citizen Scientists
suchen sie jetzt nach weiteren Knochen, um mehr über Udos Alltag zu
erfahren. ZEIT-WISSEN-Redakteurin Hella Kemper hat mitgegraben – und
auch etwas entdeckt.
Im zweiten Beitrag spulen wir ein paar Millionen Jahre vor, in die
Jungsteinzeit: Jäger und Sammler werden sesshaft und fackeln für
Viehhaltung und Landwirtschaft ganze Wälder ab. Ruß und Feinstaub legen
sich über Europa wie ein Sonnenschirm und kühlen die Erde, während
Treibhausgase bereits vor 8.000 Jahren zur globalen Erwärmung beitragen.
Obwohl damals viel weniger Menschen lebten, hatte ihr Verhalten eine
ähnliche Wirkung aufs globale Klima wie die Industrialisierung – mit
einem entscheidenden Unterschied (14:50).
Außerdem: Warum sind die Neandertaler ausgestorben? Christoph Drösser
diskutiert ein rätselhaftes Szenario. (23:25)
Eine kostenlose Probeausgabe des ZEIT-WISSEN-Magazins erhalten Sie unter
http://www.zeit.de/wissen-podcast.
Wir freuen uns über Feedback und Ideen an [email protected].
Shownotes: Die Ausstellung Light my Fire – Mensch macht Feuer ist im
Archäologischen Museum zu sehen.
In dem Buch –Feuer fangen– beschreibt Richard Wrangham, "wie uns das
Kochen zum Menschen machte" (DVA).
Drei Forschungsarbeiten zum Einfluss der Steinzeitmenschen auf das
Klima:
Kaplan, Jed O. et al. (2016): The biogeophysical climatic impacts of
anthropogenic land use change during the Holocene. Climate of the Past.
12. 923-941.
Tallavaara, Miika et al. (2015): Human population dynamics in Europe
over the Last Glacial Maximum.
Kaplan, Jed O. et al. (2016): Large Scale Anthropogenic Reduction of
Forest Cover in Last Glacial Maximum Europe.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Eis kann in den Bergen Felswände stabil halten. Am Nordpol schafft es
einzigartige Ökosysteme und macht aus dem Boden einen riesigen
Kohlenstoffspeicher. In der neuen Folge des ZEIT-WISSEN-Podcasts_ Woher
weißt du das?_ geht es um das vermeintlich ewige Eis. Was passiert, wenn
dieses Eis gar nicht mehr ewig ist, sondern durch die globale Erwärmung
auftaut?
Linda Fischer spricht mit Max Rauner über ihre Recherche im Schweizer
Dorf Kandersteg, das bedroht ist, weil ein Berggipfel ins Tal rutschen
könnte. Außerdem geht es um die Frage, was tauender Permafrost
eigentlich für den Planeten bedeutet.
In der unmöglichen Kolumne sucht Christoph Drösser nach einer Erklärung
dafür, warum der Wind in unseren Breiten immer schwächer zu wehen
scheint (20:21).
Shownotes:
- Eine Reportage über das Dorf Kandersteg von Linda Fischer
- Ein Fachartikel zum Risikomanagement am "Spitze Stei"
(Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen: Hählen et al., 2022)
- Das ewige Eis in Hessen, erklärt auf einer Informationsseite des
Kultur- und Geschichtsvereins Frickhofen e. V..
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
15 Prozent der Deutschen sind tätowiert, bei den unter 34-Jährigen sogar
30 Prozent. Kann man von den Tattoos auf die Persönlichkeit oder die
Biografie eines Menschen schließen? Wie haben sich Tattoo-Motive im
Laufe der Zeit verändert? Und was sagt uns eigentlich ein Arschgeweih?
Die Psychologie sucht nach Zusammenhängen von Tattoos und
Persönlichkeitsmerkmalen. Die Semiotik versucht die Symbole zu
entschlüsseln. Und die Kunstgeschichte hat den Tattoo-Künstler in
Hamburg St. Pauli aufgespürt, der das Tätowieren in Deutschland populär
gemacht hat. Eine Reportage zwischen Tattoo-Studio und
Psychologieseminar.
Außerdem: Warum bleibt Tattoo-Tinte so lange unter der Haut, ohne vom
Körper abgebaut zu werden? Christoph Drösser berichtet über den Stand
der Forschung (17:30).
Eine kostenlose Probeausgabe des ZEIT WISSEN Magazins erhalten Sie unter
zeit.de/wissen-podcast
Wir freuen uns über Feedback und Ideen an [email protected]
Shownotes:
Das Buch des Soziologen Chris Martin über die Bedeutung von Tattoos: The
Social Semiotics of Tattoos
Erich Kastens Fachartikel über die Beweggründe, sich tätowieren zu
lassen, [ist hier zu
finden].(https://www.researchgate.net/publication/344451195_Large_Tattoos_and_Personality_Which_Women_are_at_Risk).
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
In Deutschland hat sich die Lebenserwartung verglichen mit vor 100
Jahren verdoppelt. Unter Männern liegt sie derzeit bei knapp 79 Jahren,
unter Frauen bei etwas mehr als 83 Jahren. Was wäre, wenn wir einmal
alle 120 Jahre alt werden könnten – so wie die Supercentenarians, die
wenigen Superalten, die die 110-Jahre-Marke knacken? Forschende sind auf
der Suche nach allen möglichen Stellschrauben, um das Alter von Menschen
zu verlängern.
In der neuen Folge des ZEIT-Wissen-Podcasts spricht unser Host Linda
Fischer mit ihrem Kollegen Jens Lubbadeh über Ideen zur
Lebensverlängerung. Was für Ansätze hat die Wissenschaft, dass Menschen
älter werden als bisher? Fest steht: Die Gene und Ernährung machen einen
Unterschied.
Doch darüber hinaus: Ist die sogenannte Vampirkur (14:03) eine Option?
Transfusionen mit dem Blut von jungen Mäusen hatte in Experimenten eine
verjüngende Wirkung auf alte Tiere. Nun suchen Wissenschaftlerinnen auch
im Blut junger Menschen nach diesen Jungbrunnenstoffen. Wer sie findet,
dem winken Ruhm und Reichtum.
Und was ist mit der Yamanaka-Kur? 2007 entdeckte der Japaner Shinya
Yamanaka, dass man Körperzellen in ihren embryonalen Urzustand
zurückversetzen kann – mit nur vier Proteinen. Kann man damit vielleicht
auch ganze Körper verjüngen? (19:41).
Außerdem: Christoph Drösser geht in seiner unmöglichen Kolumne der Frage
nach, wie alt Menschen wohl maximal werden könnten (23:40).
Shownotes:
- Das Buch von Thomas Ramge: "Wollt ihr ewig leben?", Reclam-Verlag
- "Schaffen wir es, 400 Jahre lang neugierig zu bleiben?" – Jens
Lubbadeh hat Thomas Ramge für ZEIT ONLINE interviewt.
- Neben Vampir- und Yamanaka-Kur – Welche Strategien verfolgen
Forscher noch, um das Alter aufzuhalten? Übersichtsartikel von Jens
Lubbadeh auf ZEIT ONLINE.
- Mehr über die Vampirkur, Tony Wyss-Corays Forschung und die Ware
Blut kann man in diesem ZEIT-WISSEN-Text erfahren.
- Ein Artikel über die Xenotransplantationen zur Verjüngung von
Männern, die Serge Voronoff in den Zwanzigerjahren vorgenommen hat
(Baylor University Medical Center Proceedings: Cooper, 2017).
- Die Parabiose-Experimente noch einmal genauer dargestellt.
- Die Geschichte über die Entstehung der Horvath-Clock können Sie hier
nachlesen (englisch).
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Warten ist lästig, und das wird sich auch nie ändern? Falsch. Manche
Menschen warten sogar mit Genuss. Andere kennen Tricks, mit denen die
Wartezeit verfliegt.
Geduld ist eine Zutat für gutes Essen. Denn Zeit fügt einem Lebensmittel
vieles hinzu, etwa: Aufmerksamkeit, eine Prise Demut und Vorfreude. Beim
Räuchern ist das zum Beispiel so. Hella Kemper hat es im Schwarzwald bei
Räuchermeister Michael Wickert gelernt. Sie hat Holz gekauft und Späne.
Hat dann eine Forelle über Nacht in Salzlake eingelegt. Dann hat sie ein
Feuer entfacht und gewartet, bis die Glut genau richtig war – dann kam
der Fisch in den Ofen und der Rauch konnte sich an die Arbeit machen.
Eine Mahlzeit, so viele Stunden. Für sie war das Warten auf den ersten
Bissen eine Freude. Dabei ist sie sonst eher ungeduldig.
Außerdem (15:50) hat Sarah Bayerschmidt mit Experten gesprochen, die ihr
von den Freuden des Wartens erzählt haben. Ein Betriebswissenschaftler
und ein Psychologe haben ihr verraten, wie man so wenig wie möglich
davon merkt.
Und Christoph Drösser geht in seiner unmöglichen Kolumne (21:10) der
Frage nach: Warum erscheint uns die Hinfahrt zu einem Urlaubsziel viel
länger als die Heimreise?
Eine kostenlose Probeausgabe des ZEIT-WISSEN-Magazins erhalten Sie unter
zeit.de/wissen-podcast.
Wir freuen uns über Kritik, Lob und Themenwünsche an
[email protected].
Shownotes:
Der MPI-Physiker Thomas Vilgis hat zusammen mit dem Koch Rolf Caviezel
ein Buch über Koch- und Gartechniken geschrieben, in dem er erklärt, was
beim Räuchern physikalisch und chemisch geschieht. Vilgis ist auch
Herausgeber der Zeitschrift Culinaire (Zeitschrift für Kultur und
Wissenschaft des Essens), die sich in Ausgabe 13 mit dem Räuchern
befasst.
Michael Wickert hat seine Räucherei Glut & Späne 2012 in Berlin
gegründet, inzwischen befindet sie sich in Freiamt im Schwarzwald, dort
kann man freitags und samstags in der ehemaligen Metzgerei Räucherfisch
kaufen. Zusammen mit der Fotografin Daniela Haug hat er Das
Fischräucherbuch mit vielen Fotos, Rezepten, Anleitungen und Tipps zum
Räuchern herausgegeben.
Danke an Kai Sieverding von audiofühl für seine Unterstützung!
Kapitel:
(00:00 - 15:49) Wir räuchern und genießen jede Minute! (15:50 - 21:09)
So kann man das Warten besser machen (21:10 - 24:54) Wie lange noch? Von
der Zeitwahrnehmung bei Urlaubsreisen (24:55 - 25:55) Das steht im
ZEIT-WISSEN-Magazin
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Die Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz in den vergangenen
Jahrzehnten waren riesig. Mit ChatGPT kann jeder ausprobieren, was
Computer mittlerweile leisten. Das Tool hat das Abitur in Bayern
bestanden, schreibt sinnvolle E-Mails, hilft beim Programmieren und kann
sogar – auch wenn das natürlich eine Geschmacksfrage ist – lustige Witze
erzählen:
Warum hat der Mathematiker Probleme mit seinem Garten? Weil er ständig
Wurzeln zieht!
Auffällig dabei: Die Witze fangen eigentlich immer mit "Warum" an. Woran
liegt das? In der neuen Folge des ZEIT-Wissen-Podcasts spricht unsere
Host Linda Fischer mit ihrer Kollegin Elena Erdmann darüber, wie die
Technologie hinter ChatGPT funktioniert. Dass das Programm nicht
schreibt, sondern rechnet, dass es manchmal seltsam gewichtet und
Ressentiments wiederholt. Wir erklären, welche faszinierenden
Erkenntnisse sich daraus über die Texte von ChatGPT ableiten lassen.
Dabei geht es auch darum, was das Tool nicht kann und welche Risiken
durch künstliche Intelligenz gerade unter Fachleuten diskutiert werden
(26:03).
Außerdem: Christoph Drösser geht in seiner unmöglichen Kolumne (34:11)
der Frage nach, warum es Kindern so leicht fällt, sprechen zu lernen.
Weitere Links und Quellenhinweise:
- ChatGPT selbst ausprobieren: https://openai.com/blog/chatgpt
- Wie intelligent ist ChatGPT-4? Eva Wolfangel hat sich die Frage auf
ZEIT ONLINE gestellt.
- Was passiert, wenn sich ChatGPT wie ein Psychotherapeut benimmt. Ein
Artikel von Jakob Simmank auf ZEIT ONLINE.
- Jakob von Lindern und Jochen Wegener haben mit Sam Altman, dem CEO
von OpenAI, gesprochen.
- So lernte Künstliche Intelligenz 2015, Videospiele zu spielen.
- Das berühmte Paper, in dem Transformer-Modelle vorgestellt wurden –
die Technologie, die auch bei ChatGPT verwendet wird: Attention is
all you need (Vasvani et al.)
- Auch Künstliche Intelligenz hat Vorurteile, das zeigte 2016 das
Paper Man is to computer programmer as woman is to homemaker
(Bolukbasi et al.).
Wir freuen uns über Kritik, Lob und Themenwünsche an
[email protected].
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
- Näytä enemmän