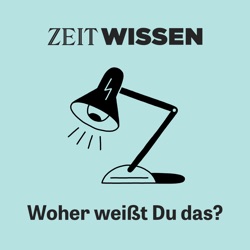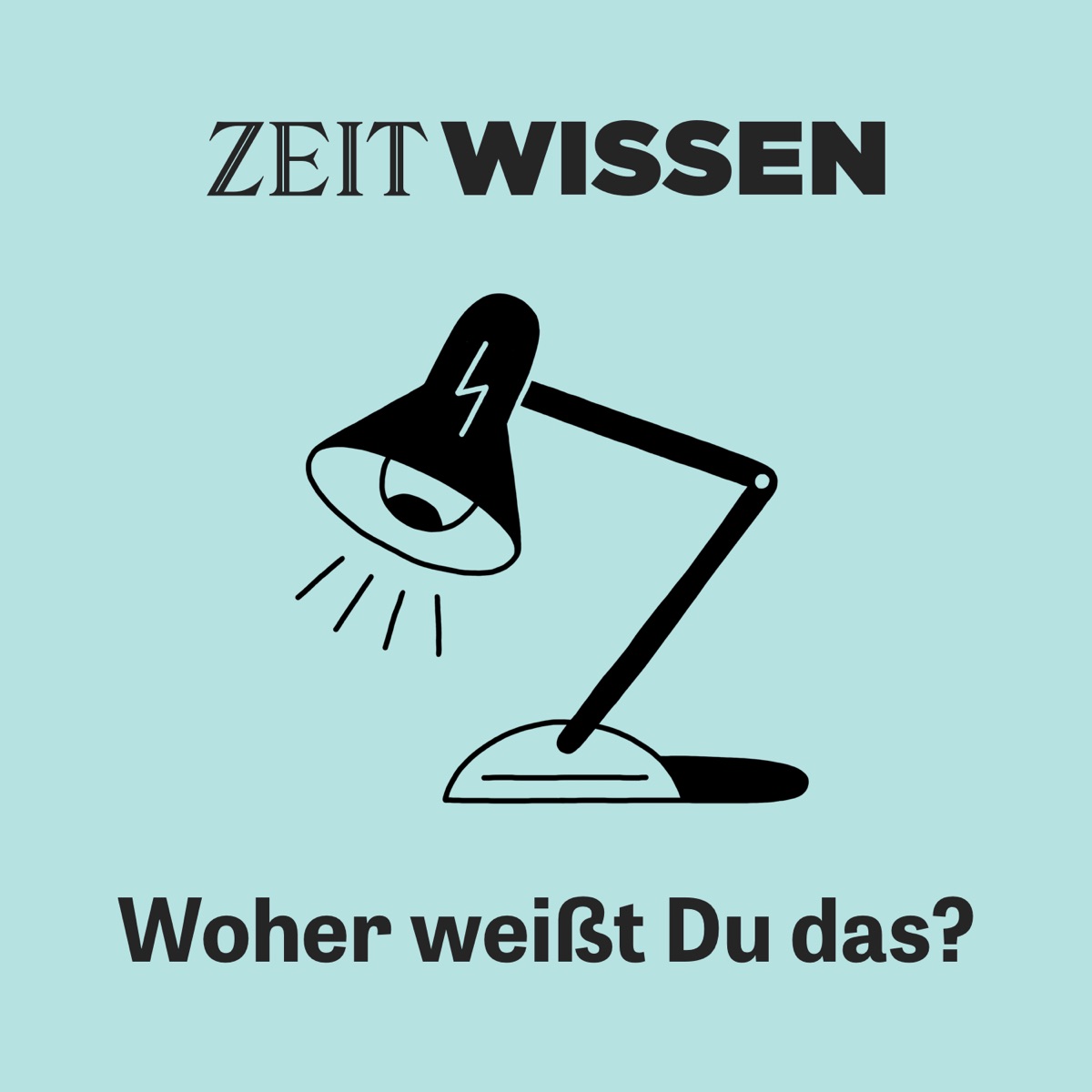エピソード
-
Es ist doch leider so: Sich wirklich gesund zu ernähren, ist
anstrengend. Wer sich beim Essen etwas gönnen möchte, wählt oft die
ungesündere Mahlzeit. Die Ursachen dafür liegen zum Teil in der
menschlichen Natur, unsere Gene können wir nicht beeinflussen. Doch, was
wir ekelig und was wir köstlich finden, können wir zumindest teilweise
trainieren. ZEIT-ONLINE-Reporterin Friederike Walch-Nasseri hat ein
Geschmacksseminar besucht, um ihre Sinne zu trainieren.
Christoph Drösser geht in seiner Kolumne der ungeklärten Frage nach, wie
viele Grundgeschmacksarten der Mensch tatsächlich spüren kann – neben
den fünf wichtigsten Sauer, Salzig, Bitter, Süß und Umami.
Shownotes:
- Wie schmeckt das wirklich? Mit dieser ZEIT-ONLINE-Serie geht es
geschmacklich auf Weltreise.
- Rot, prall und schmeckt nach nix: In diesem ZEIT-ONLINE-Text wird
die perfekte Tomate gesucht.
- Studie: Kinder, denen von Klein auf viele Geschmacksrichtungen
präsentiert werden, entwickeln seltener Lebensmittel-Abneigungen.
- Studie: Erwachsene mögen Vanille oft besonders gern, wenn sie als
Säuglinge Formula-Milch mit Vanillegeschmack getrunken haben.
- Studie: Karottengeschmack kommt bei Babys besonders gut an, wenn die
Mütter während Schwangerschaft und Stillzeit Karottensaft getrunken
haben.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT-WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Wer haftet dafür, wenn der Klimawandel Schaden anrichtet? Wenn
Wirbelsturm Freddy ein Dorf zerstört, wenn Ernten ausfallen, wenn
Menschen durch den Meeresspiegelanstieg vertrieben werden? Antwort: wir.
Oder genauer: die Industrienationen, die in großen Mengen Treibhausgase
in die Atmosphäre emittieren. Das ist jedenfalls die Idee des
Loss-and-Damage-Fonds, den die internationale Klimakonferenz 2021
beschlossen hat. Die Einrichtung dieser Entschädigungszahlungen wurde
als Durchbruch gefeiert, aber bis heute ist kein einziger Euro
ausgezahlt worden.
Nun kommt Bewegung in die Sache. ZEIT-Reporter Fritz Habekuß hat Dörfer
in Malawi besucht und den Weg von Entschädigungszahlungen von Europa
nach Afrika verfolgt. Was ist der Unterschied zur klassischen
Entwicklungshilfe? Für welche Art von Naturkatastrophen gilt die
Haftung? Und wie erleben Betroffene die Situation? Antworten im
@zeitwissen-Podcast.
Außerdem geht Christoph Drösser in seiner unmöglichen Kolumne der Frage
nach, ob man Menschen mit psychologischen Methoden – englisch: Nudging –
zum Klimaschutz verführen kann.
Eine kostenlose Probeausgabe des ZEIT-WISSEN-Magazins erhalten Sie unter
zeit.de/wissen-podcast.
Kapitel
(00:00) Intro
(00:50) Wirbelsturm Freddy zerstört ein Dorf
(01:36) Joyce Kheston verliert ihr Haus
(03:40) Was Freddy angerichtet hat
(06:08) Die Idee der Klimafolgen-Entschädigung
(07:31) War Freddy eine Folge des Klimawandels?
(09:24) Wie Cecilia und Alice die Dürre erlebten
(10:31) Klimafolgen sind nicht genderneutral
(12:43) Der Unterschied zur Entwicklungshilfe
(15:10) Der Durchbruch von Glasgow
(18:02) Plan D der Klimapolitik
(19:42) Kolumne: Verführung zum Klimaschutz
Shownotes
Der Artikel von Fritz Habekuß über den Klimafonds steht hier auf ZEIT
ONLINE.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT-WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
エピソードを見逃しましたか?
-
Immer mehr, immer jüngere Menschen haben ein Smartphone. Eltern fragen
sich, wie schädlich das für ihre Kinder ist. Welche Apps sind okay ab
welchem Alter? Wie gefährlich ist TikTok? Ist es sinnvoll, die
Bildschirmzeit zu kontrollieren? Und: Sind wir vielleicht alle selbst
schon abhängig von den Geräten, die wir überall mit hinnehmen? Viele
Forschende warnen davor, Smartphones zu früh und zu lange zu nutzen,
besonders für Kinder sei das gefährlich. Die Psychologin Amy Orban war
eine von ihnen. Heute sagt sie: Die Forschung kann viele Vermutungen
noch gar nicht belegen. Lisa Hegemann leitet das Digitalressort von ZEIT
ONLINE und hat Amy Orben im britischen Cambridge besucht.
In seiner unmöglichen Kolumne sucht Christoph Drösser außerdem Antworten
auf die Frage, warum sich Jungen so viel mehr zu Computerspielen
hingezogen fühlen als Mädchen.
Ab welchem Alter würden Sie Ihrem Kind ein Smartphone erlauben? Haben
Sie eigene Erfahrungen damit, wie schwer es ist, Regeln durchzusetzen –
oder sich selbst an welche zu halten? Schreiben Sie es uns. Wir freuen
uns auch über Kritik, Lob und Themenwünsche an [email protected].
Eine kostenlose Probeausgabe des ZEIT-Wissensmagazins erhalten Sie unter
zeit.de/wissen-podcast.
(Wenn Werbung eingespielt wird, verschieben sich die Kapitel um circa 45
Sekunden.)
Shownotes
Lisa Hegemanns Text über Smartphones und Kinder finden Sie auf ZEIT
ONLINE. Die Quellen zu ihrer Recherche finden Sie hier.
Mehr Informationen zum Gamingverhalten von Jungs und Mädchen finden Sie
hier oder hier.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT-WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Arbeit ist das halbe Leben, heißt es. Das kann man wörtlich nehmen. Denn
Studien zeigen: Der Beruf prägt unsere Persönlichkeit mitunter stärker
als so manches private Ereignis. Forschende haben Tausende
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über Jahrzehnte befragt und versucht
herauszufinden, wie unterschiedliche Berufe die Menschen verändern.
Werden Bankerinnen auch im Privaten akribischer, Lehrer pedantischer und
Schreiner genauer? Darauf antworten Fachleute im ZEIT-WISSEN-Podcast.
Im zweiten Beitrag geht es um den heiklen Übergang vom Berufsleben in
die Rente. Mit dem Job fällt plötzlich ein wichtiger Teil des Lebens
weg. Das ist nicht immer leicht. Wir begleiten einen Rentner aus
Deutschland, der sein Wissen im Ausland weitergibt – Dank einer
Organisation, die Fachkräfte im Ruhestand mit Unternehmen in aller Welt
zusammenbringt.
Außerdem geht Christoph Drösser in seiner unmöglichen Kolumne der Frage
nach, warum ausgerechnet Länder mit hoher Gleichberechtigung einen
niedrigen Anteil von Frauen in Mathematik, Technik und
Naturwissenschaften haben.
Eine kostenlose Probeausgabe des ZEIT-Wissensmagazin erhalten Sie unter
zeit.de/wissen-podcast.
Wir freuen uns über Feedback und Ideen! Schreiben Sie an
[email protected].
(00:00) Intro
(02:09) Wie der Beruf uns verändert
(04:36) Berufseinsteiger werden gewissenhafter
(08:48) Kann der Beruf dich umkrempeln?
(10:06) Wie die Persönlichkeit die Berufswahl beeinflusst
(11:27) Wovon beruflicher Erfolg abhängt
(13:53) Wenn Rentner weiterarbeiten wollen
(18:00) Der Rentnerverleih SES
(21:48) Depressionen im Ruhestand
(23:22) Die unmögliche Kolumne
(27:15) Vorschau
(Wenn Werbung eingespielt wird, verschieben sich die Kapitel um circa 45
Sekunden.)
Shownotes
Eine Überblicksstudie aus dem Jahr 2023 zeigt, dass der Beruf mitunter
einen stärkeren Einfluss auf die Persönlichkeit hat als
Liebesbeziehungen.
Steve Woods zeigt in dieser Arbeit die Wechselwirkungen zwischen Beruf
und Persönlichkeit auf, außerdem forscht er zur Kindheit und dem
späteren Job.
Jaap Denissen hat die Selbstbeschreibungen von Beschäftigten mit den
Erwartungen an sie verglichen.
Eva Asselmann hat zum Start und Ende des Arbeitslebens geforscht und ein
Buch zu den Auswirkungen einzelner Lebensereignisse veröffentlicht.
Chia-Huei Wu ist Managementprofessor in London und hat in einer Studie
2021 zusammen mit Co-Autoren untersucht, ob das Chefwerden unsere
Persönlichkeit verändern kann.
Max Rauners Artikel aus dem ZEIT-Wissensmagazin ist hier nachzulesen.
Beim Senior Expert Service können sich Rentnerinnen und Rentner
registrieren lassen, die ihre Expertise ehrenamtlich weitergeben
wollen.
Die Maismühle von Serghei und Ala Nichita in Iurceni, Moldau, ist über
Facebook erreichbar.
Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser bezieht sich auf drei
Studien: "The Gender-Equality Paradox in Science, Technology,
Engineering, and Mathematics Education"; die erwähnte französische
Studie "Gender stereotypes can explain the gender-equality paradox"; die
Bonner Studie: "Relationship of gender differences in preferences to
economic development and gender equality".
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT-WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Die größten Staaten der Welt, Raumfahrtagenturen und Milliardäre, sie
alle arbeiten daran, Menschen auf den Mars zu bringen. Nur noch ein paar
Jahre, dann soll es so weit sein. Im ZEIT-Wissen-Podcast sprechen wir
darüber, was sie bedenken müssen, damit die Marsreisenden nicht mit
ihrem ersten Schritt auf die Marsoberfläche sterben. Und, sollte die
Ankunft glücken: wie sie die Mission langfristig überstehen, ohne dabei
durchzudrehen.
Helfen sollen dabei Vorbereitungsmissionen wie Chapea: Eine kleine
Gruppe Menschen verbringt viele Monate in einer umgebauten Lagerhalle in
Texas – und spielt Marsmission. ZEIT-ONLINE-Wissensredakteurin Viola
Kiel hat mit einem von ihnen gesprochen, besser gesagt: Sie hat es
versucht. Denn die Kontaktmöglichkeiten zum Mars sind beschränkt, auch
wenn das Mars-Habitat in diesem Fall nur ein paar Tausend Kilometer
entfernt ist. Welche Herausforderungen werden auf Astronautinnen und
Astronauten zukommen? Was werden sie vermissen? Welche Eigenschaften
sind nötig, damit so eine Mission gelingt? Fragen, die die
Weltraumagentur Nasa gerade versucht, zu beantworten.
In seiner Kolumne schaut Christoph Drösser auf die Marsoberfläche. Sind
darauf etwa ehemalige Flüsse und Seen zu erkennen? Lange muss es darauf
Wasser gegeben haben. Warum ist es aber verschwunden?
Wir freuen uns über Feedback und Ideen an [email protected].
Shownotes:
- Komm, wir spielen Marsbesiedlung: Der Artikel von Viola Kiel auf
ZEIT ONLINE.
- Der Nasa-Podcast, in dem die vier Chapea-Teilnehmenden über ihre
Erfahrungen berichten.
- Studie zu einem Experiment, das vergleichbar ist mit Chapea (PNAS:
Basner et al. 2013).
- Forscherinnen und Forscher haben nach den Ursachen des
verschwundenen Wassers auf dem Mars gesucht.
- Hatte der Mars einmal eine wärmende Atmosphäre? Eine Antwort könnten
Eiswolken liefern, wie eine Studie zeigt.
Kapitel
(00:00) Intro
(02:24) Wann der Mensch auf dem Mars landen könnte
(04:05) So tödlich ist der Mars
(07:31) So schützen sich Astronautinnen und Astronauten
(08:43) Die Mission Chapea
(12:35) Drehen Marsreisende irgendwann durch?
(15:46) Wie Kommunikation zum Mars funktioniert
(17:10) Was wir auf dem Mars vermissen
(22:23) Die Unmögliche Kolumne: Warum ist der Mars so trocken?
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT-WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Im Südosten des afrikanischen Kontinents ließ die Regierung von Malawi
Elefanten in den Kasungu-Nationalpark umsiedeln. Die Population erholte
sich, doch die Tiere verwüsteten angrenzende Felder und töteten
Menschen. Warum hat der Elektrozaun sie nicht abgehalten? Was fordern
die Bauern, was sagt die Regierung? Und was kann Deutschland aus dem
Konflikt lernen für die Koexistenz von Wolf und Mensch? Fritz Habekuß
hat in Malawi Dörfer am Rand des Nationalparks besucht und mit
Artenschützerinnen über den Konflikt Mensch gegen Tier gesprochen.
Außerdem sortiert Christoph Drösser in seiner unmöglichen Kolumne den
Forscherstreit über die “Feenkreise” in Namibia: Hunderte von kahlen
Kreisen in der Grassteppe. Es muss sich um ein natürliches Phänomen
handeln. Aber um was für eins?
Eine kostenlose Probeausgabe des ZEIT WISSEN Magazins erhalten Sie unter
zeit.de/wissen-podcast
Wir freuen uns über Feedback und Ideen! Schreiben Sie an
[email protected].
Den Artikel von Fritz Habekuß über die Umsiedlung der Elefanten finden
Sie auf zeit.de
Kapitel
(00:00) Intro
(03:57) Fußabdrücke im Feld
(07:18) Was sagt die Regierung?
(09:21) Die Position der NGO
(11:42) Ein Zaun soll helfen
(14:16) Wie aggressiv sind Elefanten?
(15:13) Ein Elefant tötet Masiye
(18:12) Parallelen zu Wolf und Mensch in Deutschland
(22:44) Wie geht es in Malawi weiter?
(23:56) Das Rätsel der Feenkreise
(27:57) Ausblick
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT-WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Kim Kardashian hat es getan, unser Autor auch: Ganzkörper-MRTs
versprechen, mögliche Erkrankungen so früh zu erkennen, dass Ärzte
vielleicht noch rechtzeitig eingreifen und sie bekämpfen können.
ZEIT-Redakteur Johannes Gernert spricht mit Podcasthost Maria Mast im
neuen Wissenspodcast Woher weißt du das? über das, was er dabei über
sich selbst gelernt hat. Wie wissenschaftlich fundiert ist der Trend
aus den USA? Ab wann gilt ein Befund als Krankheit? Und wie geht unser
Autor mit der Nachricht um, dass in seinem Körper etwas Ungewöhnliches
entdeckt wurde?
In seiner unmöglichen Kolumne spricht Christoph Drösser außerdem über
das Rätsel von Mozarts Tod. Der ist mit 35 gestorben – und bis heute
rätselt die Wissenschaft woran.
Würden Sie ein Ganzkörper MRT machen? Schreiben Sie es uns. Wir freuen
uns auch über Kritik, Lob und Themenwünsche an [email protected].
Eine kostenlose Probeausgabe des ZEIT-Wissen-Magazins erhalten Sie unter
zeit.de/wissen-podcast.
Alle Folgen und Quellen des ZEIT-WISSEN-Podcasts sind auf dieser Seite
gesammelt.
(00:00) Intro
(01:34) Was passiert bei einem Ganzkörper-Scan?
(04:33) Ab wann ist etwas eine Krankheit?
(06:48) Eine Zyste im Gehirn?
(11:08) Wie sinnvoll sind Ganzkörper-Scans?
(17:29) Kolumne: Das Rätsel um Mozarts Tod
(falls am Anfang Werbung geschaltet ist, verschieben sich die Kapitel um
circa 45 Sekunden)
Shownotes
- Johannes Gernerts Text über sein Ganzkörper-MRT.
- Die Nako-Gesundheitsstudie.
- Was man über Mozarts Tod weiß.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT-WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Baden im kalten Fluss, übernachten im Wald oder einfach nur auf dem
Balkon oder im Garten – das sind Mikroabenteuer. Wer sich darauf
einlässt, wird belohnt. Das zeigt die Forschung, und das berichten
Christo Foerster und Johanna Hombergs aus Erfahrung. Im ZEIT
WISSEN-Podcast geben sie Tipps, wie wir schnell und einfach aus dem
Alltag ausbrechen können. Hombergs kann Dachsspuren erkennen und
Unterschlüpfe im Wald bauen, Foerster hat die Mikroabenteuer in
Deutschland populär gemacht. Wie man durch kleine Abenteuer den
Flow-Zustand erreicht, erklärt der Hirnforscher Surjo Soekadar von der
Charité in Berlin. Und Christoph Drösser geht in seiner unmöglichen
Kolumne der Frage nach, warum Teenager risikofreudiger sind als Menschen
in anderen Altersgruppen.
Eine kostenlose Probeausgabe des ZEIT WISSEN Magazins erhalten Sie unter
zeit.de/wissen-podcast.
Wir freuen uns über Feedback und Ideen! Schreiben Sie an
[email protected].
(00:00) Intro
(02:07) Mikro- und Makroabenteuer
(09:20) Im Wald überleben
(13:37) Kinder und Abenteuer
(16:41) Der erste Schritt
(18:28) Wie wir durch Abenteuer wachsen
(21:55) Warum Teenager das Risiko suchen
(26:17) Tipps für Mikroabenteuer
Shownotes
Das neue Buch von Christo Foerster heißt Am besten draußen und ist bei
Malik erschienen. Seine Webseite findet ihr hier, seinen Podcast hier.
Die Webseite der Survivalschule von Johanna Hombergs ist
schattenwolf-wildnisschule.de.
Die Fachartikel von Surjo Soekadar sind bei Google Scholar zu finden.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT-WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Sie funkeln hell, sie kosten viel und der Mensch will sie unbedingt
besitzen. Doch damit er an Diamanten kommt, braucht es eine gewaltige
Explosion aus dem Inneren unseres Planeten.
Wo Diamanten ihren Ursprung haben und warum sie so besonders sind,
darüber spricht Podcast-Host Linda Fischer in dieser Episode mit
Geologin und ZEIT-ONLINE-Wissensredakteurin Claudia Vallentin.
In seiner Kolumne schaut Christoph Drösser auf eine ganz besondere Art
von Diamanten, die Carbonados. Denn woher sie kommen, ist seit Langem
ein Rätsel. Sind sie vielleicht das Resultat eines außerirdischen
Besuches?
Wir freuen uns über Feedback und Ideen an [email protected]. Alle
Folgen des ZEIT-Wissen-Podcasts sind auf dieser Seite gesammelt.
(00:00) Intro
(02:20) Nein, Superman könnte keine Diamanten herstellen
(04:16) Die richtigen Bedingungen, damit Diamanten entstehen können
(08:43) Wie der Mensch an Diamanten kommt
(16:27) Warum Menschen so fasziniert von Diamanten sind
(22:02) Blutdiamanten
(26:50) Die unmögliche Kolumne: Woher kommen die schwarzen Diamanten?
Shownotes:
- Als Forscherinnen und Forscher vermuteten, dass es auf Uranus oder
Neptun Diamanten regnen könnte.
- Die Studie dazu im Fachjournal Science Advances (He et al., 2022)
- Einspieler aus dem Superman-Film:
https://www.youtube.com/watch?v=JyHFPV-j8Gs
- Studie über Zusammenhang von Kimberlit-Explosionen und Riftung
(Nature: Gernon et al., 2023)
- Studie zu roten Diamanten aus Australien: (Nature Communications:
Olierook et al., 2023)
- Ausschnitt aus dem Film Blood Diamond:
https://www.youtube.com/watch?v=bOA-ZEf90pI
- Bling-Bling aus der Tiefe – ein Text von Claudia Vallentin über
Diamanten auf ZEIT ONLINE
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT-WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Nachts verwandelt sich der Mensch. Sorgen erscheinen nachts größer als
tagsüber, Gefühle intensiver, Fantasien fantastischer. Es gibt berühmte
Nachteulen wie Madonna und Schiller, die nachts besonders kreativ waren
oder sind. Die Wissenschaft hat einen Verdacht, welche Mechanismen dafür
verantwortlich sind – und wie man sie beeinflussen kann. Im
ZEIT-WISSEN-Podcast erklären Forschende, Reporterinnen und Künstlerinnen
die Nachtseite des Menschen.
Außerdem geht Christoph Drösser der Frage nach, warum die Mehrzahl der
Erwachsenen beim Einschlafen zuckt.
Eine kostenlose Probeausgabe des ZEIT-WISSEN-Magazins erhalten Sie unter
zeit.de/wissen-podcast.
Wir freuen uns über Feedback und Ideen an [email protected]
(00:00) Intro
(02:23) Die Künstlerin der Nacht
(05:01) Das Gehirn nach Mitternacht
(07:17) Berühmte Nachteulen
(09:12) Nächtliche Grübelschleifen
(12:23) Das Melatonin-Rätsel
(14:42) Sich die Nacht zunutze machen
(18:03) Schlafstörungen
(20:42) Einschlafzuckungen
(24:44) Ausblick
Shownotes:
Über die "Mind-after-Midnight-"Hypothese schreibt Max Rauner in diesem
ZEIT-WISSEN-Artikel.
Der Fachartikel von Andrew Tubbs über die
"Mind-after-Midnight"-Hypothese ist hier zu finden.
Der erste Teil der ZEIT-WISSEN-Serie über die Nacht ist hier
nachzulesen.
Der Schlafforscher Jürgen Zulley schreibt über seine Experimente und
Forschung auf seiner privaten Website.
Das Buch "Sleepless" von Annabel Abbs ist unter anderem bei Thalia
erhältlich.
Auszüge aus dem Gespräch des "Rolling Stone"-Magazins mit Madonna und
Maluma sind auf YouTube zu sehen.
Die Website der Künstlerin Silke Silkeborg: silke-silkeborg.de
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT-WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Die Eingeweide und das Gehirn raus, dann trocknen, einbalsamieren und
einwickeln: Die alten Ägypter wussten, wie man einen toten Körper fit
macht für die Ewigkeit. Dafür interessieren sich damals wie heute nicht
nur Forschende, sondern auch Abenteurerinnen, Abergläubische und
Grabräuber.
In den vergangenen Jahrhunderten brachten reiche Reisende Mumien im
Gepäck von Ägypten nach Europa. Vor welche Schwierigkeiten das
Archäologen heute stellt und warum sich der europäische Adel im 19.
Jahrhundert zur Mumienparty traf, darüber sprechen Podcasthost Maria
Mast und ZEIT-ONLINE-Wissensredakteurin Viola Kiel im neuen
Wissenspodcast Woher weißt Du das?
Außerdem beschäftigt sich Christoph Drösser in seiner unmöglichen
Kolumne mit der Frage, wie es vor Jahrtausenden bereits möglich war,
tonnenschwere Steinblöcke zu Pyramiden aufzustapeln. Fest steht
jedenfalls, dass die alten Ägypter die 146 Meter hohe Cheopspyramide
ohne elektrischen Kran gebaut haben.
Wie oft denken Sie ans alte Ägypten? Schreiben Sie es uns. Wir freuen
uns auch über Kritik, Lob und Themenwünsche an [email protected].
Eine kostenlose Probeausgabe des ZEIT-Wissensmagazins erhalten Sie unter
zeit.de/wissen-podcast.
Alle Folgen und Quellen des ZEIT-Wissenspodcasts sind auf dieser Seite
gesammelt.
(00:00) Intro
(02:09) Die Mumienmanie des 19. Jahrhunderts
(06:34) Enttäuschung auf der Mumienparty
(08:30) Die Heilkräfte zermahlender Mumien
(11:27) Was Wissenschaftler heute an Mumien erforschen
(16:54) Kolumne: Das Rätsel um den Pyramidenbau
(falls am Anfang Werbung geschaltet ist, verschieben sich die Kapitel um
ca. 45 Sekunden)
Shownotes
- Viola Kiel schreibt auf ZEIT ONLINE über die Mumienmanie des 19.
Jahrhunderts.
- Mehr zu den Mumienfunden in der Jenaer Sammlung lesen Sie hier oder
hier: Paust et al., 2023.
- Wie tonnenschwere Steinblöcke zum Pyramidenbau transportiert wurden:
PNAS: Sheisha et al., 2020.
- Dieses Video zeigt eine Theorie zum Bau der Pyramiden.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT-WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Pupsen ist normal. Wir alle tun es. Aber die wenigsten reden darüber.
Wer beim Pupsen ertappt wird, schämt sich. Warum eigentlich? Das
erklären eine Anthropologin und eine Psychologin im ZEIT WISSEN-Podcast.
Der Gastroenterologe Martin Storr spricht über medizinische Aspekte: Wie
viel pupsen ist normal? Welche Lebensmittel verursachen den meisten
Gestank? Und warum pupst man im Flugzeug mehr als gewöhnlich? Fun Fact:
Pupsen wird auch als Protestform genutzt.
Außerdem erzählt Hella Kemper von Tieren, die mit ihren Pupsen
kommunizieren oder sich damit verteidigen. Und Christoph Drösser
erkundet in seiner unmöglichen Kolumne die mysteriöse Verbindung von
Darm und Gehirn.
Eine kostenlose Probeausgabe des ZEIT WISSEN Magazins erhalten Sie unter
zeit.de/wissen-podcast
Wir freuen uns über Feedback und Ideen an [email protected].
(00:00) Intro
(02:59) Was sind Pupse und woher kommt das Geräusch?
(05:07) Wie viel pupsen ist normal?
(08:24) Warum sind Pupse so faszinierend?
(09:27) Pupsende Prominente
(12:41) Pups-Scham
(16:41) Pupsen als Protestform
(18:10) Pupsende Tiere
(23:50) Die Verbindung vom Darm zum Hirn
(falls am Anfang Werbung geschaltet ist, verschieben sich die Kapitel um
ca. 45 Sekunden)
Shownotes
Kirsten Bell schreibt über die Anthropologie des Alltags in ihrem Buch
"Silent but Deadly".
Martin Storr hat ein Buch über die sogenannte FODMAP-Diät
veröffentlicht: eine medizinische Ernährung, die bei übermäßiger
Gasbildung helfen könnte.
Don Corrigan schreibt über Pupsen in der Popkultur in seinem Buch "I
fart in your general direction!”
Mr. Methane pupst in einer norwegischen Talkshow.
Eine Schallplatte des Kunstfurzers Joseph Pujol wird auf Youtube
abgespielt.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT-WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Treibhausgase erwärmen die Erde, das ist bekannt. Doch die wärmsten
Jahre in der Geschichte waren häufig Jahre, in denen das "Jesuskind" die
Erde heimsuchte: El Niño, so tauften peruanische Fischer ein
Wetterphänomen, das alle paar Jahre die Fische an ihrer Küste vertreibt
und am anderen Ende der Welt für Fluten oder Dürre sorgt.
Wie all das zusammenhängt und warum dieses Wetterphänomen und sein
Gegenstück La Niña eine Menge Geld kosten, darüber sprechen Podcasthost
Linda Fischer und ZEIT-ONLINE-Wissensredakteurin Claudia Vallentin im
neuen Wissenspodcast Woher weißt du das?.
Außerdem beschäftigt sich Christoph Drösser in seiner Kolumne mit der
paradox erscheinenden Eigenschaft von Wolken, die Atmosphäre sowohl zu
erwärmen als auch zu kühlen. Was wohl mit ihnen im Klimawandel passiert?
**Shownotes: **
- Wie El Niño sich im Verlauf von 2023 langsam im Pazifik aufbaute,
ist in dieser Visualisierung auf ZEIT ONLINE zu sehen.
- Studie in der Fachzeitschrift Science zum Einfluss von El Niño auf
die Weltwirtschaft.
- Wie El Niño im Detail funktioniert – eine Übersicht von
Klimaforscher Mojib Latif.
- Vorhersage der ENSO-Phasen durch die Noaa. Die Wahrscheinlichkeit
für eine neutrale Phase ist seit Podcastaufzeichnung gestiegen und
liegt derzeit bei über 70 Prozent.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT-WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Normalerweise tickt unsere innere Uhr synchron mit dem Wechsel von Tag
und Nacht, hell und dunkel. Bei vielen Menschen, die völlig blind sind,
ist diese Synchronisation gestört, aber auch bei einigen Sehenden.
Non-24 heißt die Störung. Die Betroffenen sind phasenweise völlig
übernächtigt, haben Probleme, pünktlich zur Arbeit zu erscheinen oder
bei einem Date, sie leben dann wie in einer anderen Zeitzone. Einer von
ihnen ist der 34-jährige Stephen Larroque. In dieser Episode erzählt er
von seinem Alltag mit Non-24.
Außerdem erklärt der Schlafmediziner Ingo Fietze von der Charité in
Berlin, wie sich die innere Uhr im Laufe des Lebens verschiebt und bei
welchen Symptomen man von einer Schlafstörung spricht.
Tobias Hürter gibt Tipps für einen guten Schlaf. Und Christoph Drösser
geht in seiner unmöglichen Kolumne der Frage nach, warum Menschen
schlafwandeln.
(00:00) Intro (03:20) Die Schlafstörung Non-24 (05:40) "Dein Vater ist
ein Vampir" (10:30) Eulen und Lerchen (13:00) Schichtarbeit (15:15)
Schlaftipps von Tobias Hürter (22:45) Warum manche Menschen
schlafwandeln (26:25) Ausblick
Eine kostenlose Probeausgabe des ZEIT WISSEN Magazins erhalten Sie unter
http://www.zeit.de/wissen-podcast
Wir freuen uns über Feedback und Ideen an [email protected].
Shownotes
Stephen Larroque schreibt über sein Leben mit Non-24 und seine
Selbsttherapie-Versuche in diesem Protokoll.
In diesem Fachartikel von Ingo Fietze und anderen geht es um Non-24 und
die Behandlung der Schlaf-Wach-Rhythmusstörung mit einem Schlafmittel.
Die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und
Umweltmedizin behandeln unter anderem die Relevanz der inneren Uhr für
die Schichtarbeit und beschäftigen sich mit der Gestaltung von
Schichtarbeit unter gesundheitlichen Aspekten.
Das Buch von Tobias Hürter heißt: "Du bist, was Du schläfst"
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT-WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Es sind beunruhigende Befunde: Weltweit hat die Zahl der Spermien rapide
abgenommen, fanden die Autoren einer Metastudie im vergangenen Jahr.
2018 hatten Männer im Schnitt nur noch halb so viele Spermien im
Ejakulat wie 1973 – zuletzt beschleunigte sich die Abnahme sogar noch.
Droht der Menschheit also die Unfruchtbarkeit?
Dieser Frage ist Tom Kattwinkel, Redakteur im Gesundheitsressort von
ZEIT ONLINE, nachgegangen. Im neuen ZEIT-Wissen-Podcast führt er uns
durch die Studienlage – und was sie für die Männer von heute bedeutet.
Der israelische Epidemiologe Hagai Levine, der die Studie
mitdurchgeführt hat, erklärt, warum er sich sorgt, nicht Großvater
werden zu können. Die Urologie-Professorin Dolores Lamb hingegen
kritisiert die Schlussfolgerungen: Kaum eine Messung in der Medizin sei
so wenig standardisiert wie das Spermiogramm. Keiner wisse, ob die
Spermienzahl wirklich abnehme.
Und in der unmöglichen Kolumne geht Christoph Drösser der Frage nach,
warum immer mehr Männer Erektionsprobleme haben (21:29).
Wir freuen uns über Kritik, Lob und Themenwünsche an
[email protected].
Weitere Links zur Folge:
- Bereits 2021 berichtete Tom Kattwinkel auf ZEIT ONLINE über die
beunruhigenden Spermien-Daten.
- Als im vergangenen Jahr eine neue Metastudie erschien, nahm er das
zum Anlass, sich die Datengrundlage noch einmal kritisch
anzuschauen. Seine Analyse erschien ebenfalls auf ZEIT ONLINE.
- Und auf ihrem Instagram-Account warnt die Epidemiologin Shanna Swan,
die ebenfalls an den Studien beteiligt war, mit teils drastischen
Worten und Vergleichen vor der Abnahme der Fruchtbarkeit.
Anmerkung der Redaktion: Leider ist uns bei der Wiedergabe eines Zitats
von Shanna Swan (07:18 – 07:49) ein Fehler unterlaufen. Swan sagt nicht,
dass Männer in 20 Jahren "eigentlich gar keine Spermien mehr" hätten,
sondern dass – extrapoliere man den bisherigen Verlauf – die Hälfte der
Männer dann eine geschätze Spermienzahl von 0 haben müsste. Wir bitten,
diesen Fehler zu entschuldigen.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT-WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Ed Witten wird gerne als Einstein unserer Zeit bezeichnet. Er hat die
Stringtheorie maßgeblich mit entwickelt. Sie soll die beiden großen
Theoriegebäude der Physik – Relativitätstheorie und die Quantentheorie –
miteinander verheiraten und gilt als Kandidat für eine Theorie für
Alles. Das Problem: Die Stringtheorie sagt vorher, dass es nicht nur ein
Universum gibt, sondern eine unvorstellbar große Zahl von
Paralleluniversen, Multiversum genannt. Manche Kosmologen sehen in der
Theorie sogar Hinweise auf Doppelgänger von uns Menschen.
Im Interview mit ZEIT und ZEIT WISSEN erklärt Ed Witten, wie es zu der
Vorhersage der vielen Universen kam und warum er mit dieser Vorstellung
gerungen hat. Außerdem fragen wir ihn nach seiner Einschätzung zur
Existenz von Doppelgängern in anderen Universen. ZEIT-Redakteur Ulrich
Schnabel hat vor Jahren sowohl Ed Witten als auch den 2018 verstorbenen
Stephen Hawking getroffen und erzählt von diesen Begegnungen.
In seiner unmöglichen Kolumne geht Christoph Drösser der Frage nach,
warum in fast allen Gesellschaften Religionen entstanden sind.
Eine kostenlose Probeausgabe des ZEIT WISSEN Magazins erhalten Sie unter
zeit.de/wissen-podcast
Wir freuen uns über Feedback und Ideen an [email protected].
Die folgenden Kapitelmarken verschieben sich um etwa 45 Sekunden, falls
der Podcast Werbung enthält.
(00:00) Intro (01:50) Das Trauma, Ed Witten zu interviewen (05:10) Was
Ed Witten von Stephen Hawking unterscheidet (07:00) Ed Witten als
Einstein unserer Zeit (07:55) Das Multiversum im Hollywood-Film (11:40)
Einsteins Traum (13:00) Stringtheorie für Dummies (15:45) Das Argument
für Paralleluniversen (18:35) Occams Rasiermesser (21:28) Haben wir
Doppelgänger in Parallelwelten? (23:30) So arbeitet Ed Witten (25:20)
Christoph Drösser über den Ursprung von Religionen (29:13) Vorschau
Shownotes Das ZEIT-Interview mit Ed Witten ist hier zu finden.
Ed Witten hat bis zum 29. Juli unter @witten271 getwittert.
Pressemitteilung der Joachim-Herz-Stiftung zur Verleihung des Hamburger
Preises für Theoretische Physik an Ed Witten.
Ulrich Schnabel schreibt über seine Begegnungen mit Ed Witten und
Stephen Hawking in diesem ZEIT-Artikel.
Tobias Hürter schreibt in der ZEIT über die Stringtheorie (2014).
Tobias Hürter und Max Rauner erklären das Multiversum in ihrem Buch Die
verrückte Welt der Paralleluniversen.
Fotos: Roman Pawlowski für Die ZEIT
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT-WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Knapp 120 Jahre ist es her, dass Alois Alzheimer eine "eigenartige
Erkrankung der Hirnrinde" beschrieb. Jahre, in denen die Medizin nie ein
Mittel hatte, das gegen die Ursache der nach ihm benannten
Alzheimer-Demenz hilft. Das wird sich nun ändern. Denn in Kürze dürfte
die europäische Arzneimittelbehörde Ema Lecanemab, Handelsname Leqembi,
zur Zulassung empfehlen.
Was ist das für ein Mittel und wem kann es wirklich helfen? Was ist mit
den Hirnblutungen, die viele der Probanden in der Zulassungsstudie
betrafen? Und ist das Mittel vielleicht erst der Anfang einer
Revolution? Darüber spricht Jakob Simmank in diesem Podcast mit Ingo
Arzt, Redakteur im Gesundheitsressort.
Wir freuen uns über Kritik, Lob und Themenwünsche an
[email protected].
Weitere Links zur Folge:
- Einen ZEIT-Titel über die neuen Medikamente aus dem vergangenen Jahr
lesen Sie hier.
- Im ZEIT-ONLINE-Interview erklärt Christian Haass, wieso die neuen
Antikörper ein Durchbruch sind.
- Und hier erfahren Sie, was Demenz-Coaches machen und wieso sie für
die Krankenhausbehandlung von Alzheimer-Kranken so wichtig sind.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT-WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
80 Prozent der Deutschen haben irgendwann in ihrem Leben Probleme mit
der Wirbelsäule. Eine regelrechte Rückenschmerzindustrie hält unzählige
Angebote für sie bereit, von Spezialstühlen über Rücken-Check-ups bis
hin zu Operationen. Manches davon ist Geld- und Zeitverschwendung. Im
ZEIT-WISSEN-Podcast erklären Experten, was wirklich hilft – und wann
eine Röntgenaufnahme sinnvoll ist (12:04).
Außerdem besucht ZEIT WISSEN eine Schule für Schlangenmenschen und
fragt, ob auch sie Rückenschmerzen haben und wie sie es schaffen, ihre
Wirbelsäule so extrem zu verbiegen. (08:27)
Plus: Warum haben Menschen in manchen Kulturen keine Rückenschmerzen?
Christoph Drösser geht dieser Frage in seiner unmöglichen Kolumne auf
den Grund. (24:38)
Eine kostenlose Probeausgabe des ZEIT WISSEN Magazins erhalten Sie unter
http://www.zeit.de/wissen-podcast
Wir freuen uns über Feedback und Ideen an [email protected].
(00:00 - 01:59) Intro (02:00 - 03:53) So viele Arbeitnehmer*innen haben
Rückenschmerzen (03:54 - 08:26) Was passiert bei einem BackCheck? (08:27
- 12:03) Haben Schlangenmenschen Rückenschmerzen? (12:04 - 17:29)
Bewegung: Das Wundermittel gegen Rückenschmerzen? (17:30 - 21:36) Der
häufigste Grund für Rückenschmerzen (21:37 - 24:37) Warum Röntgen nicht
immer sinnvoll ist (24:38 - 28:39) Warum haben andere Kulturen weniger
Rückenschmerzen? (28:46 - 29:38) Mehr Wissen
Shownotes
2022 gründete Nicole Gerstner die Schule für Kontorsion Intentional
Movement Acadamy (IMA). Es gibt Kursangebote zu Stretching, Kontorsion,
Akrobatik und Luftartistik.
Die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin (DGS) und der Berufsverband
der Ärzte und Psychologischen Psychotherapeuten hat sich unter anderem
damit beschäftigt, wie viel die Versorgung von Patient*innen mit
Rückenschmerzen und deren Fehlzeiten kostet.
Der BackCheck ermittelt Kraftwerte und erstellt mittels einer Software
einen individuellen Trainingsplan. Wir haben den BackCheck beim
Unternehmen Gesundheit in Bewegung (GiB) getestet.
Dieser Fachartikel von 2008 berichtet über die Untersuchung der Rücken
von fünf Frauen, die in der Zirkusschule der Mongolei (in Ulaanbaatar)
ausgebildet worden sind.
Dieser Artikel von Cochrane fasst Studien zur Einnahme von
Schmerzmitteln und ihren Nebenwirkungen zusammen.
In diesem Artikel von Cochrane geht es um die Frage, welche Art von
Bewegung gegen Rückenschmerzen hilft.
Dieser Artikel der Bertelsmann Stiftung beziffert den Anstieg der
Wirbelsäulen-Operationen in den vergangenen 15 Jahren.
Das "Deutsche Ärzteblatt" beschäftigt sich mit den Ursachen von
Rückenschmerzen.
Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie beschreibt in ihren Leitlinien,
wann Rückenoperationen sinnvoll sind.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT-WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Das Risiko an Krebs zu erkranken, Herzinfarkte und andere Erkrankungen
werden stark von einem unaufhaltsamen Faktor beeinflusst: dem
Älterwerden. Wer lange gesund bleiben will, sollte also vor allem
versuchen, diesen Prozess zu bremsen. Aber wie? Glaubt man dem
Harvard-Genetiker und Altersforscher David Sinclair, dann hilft vor
allem eines: seltener zu essen.
In einer neuen Folge des ZEIT-WISSEN-Podcasts klären Jakob Simmank und
Linda Fischer, was hinter dem Intervallfasten-Hype steckt. Kann es
helfen, 16 Stunden am Tag nichts zu essen – also zwischen 20 Uhr abends
und 12 Uhr mittags keine Kalorien zu sich zu nehmen, weder Chips noch
Bier am Abend und nicht einmal Milch in den Kaffee am Morgen?
Jakob Simmank hat mit Morten Scheibye-Knudsen vom Center for Healthy
Aging in Kopenhagen gesprochen, der eine der wenigen klinischen Studien
zum Thema leitet, mit dem Naturheilkundler Andreas Michalsen sowie dem
Altersforscher Valter Longo, die seit Jahrzehnten zum Fasten forschen.
Und in der unmöglichen Kolumne geht Christoph Drösser der Frage nach, ob
Menschen, die moderat Alkohol trinken, wirklich länger leben (14:41).
Shownotes
Ein ZEIT-Dossier zum Thema Intervallfasten lesen Sie [hier](https://www.zeit.de/2023/31/intervallfasten-ernaehrung-gesundheit-alterung-wissen-podcast-2).
Einen ausführlichen Text über die Suche nach der perfekten Diät, erschienen in ZEIT WISSEN, lesen Sie [hier](https://www.zeit.de/zeit-wissen/2023/02/diaet-ernaehrung-abnehmen-wissenschaft).
Was gesunde Ernährung genau ausmacht, erklärt Ernährungswissenschaftler Martin Smollich im [ausführlichen Interview mit ZEIT ONLINE](https://www.zeit.de/gesundheit/zeit-doctor/2023-05/gesunde-ernaehrung-fleisch-verzicht-zucker-salz-krebs-erkrankungen).
Wir freuen uns wie immer über Kritik, Lob und Themenwünsche an
[email protected].
(00:00-02:43) Intro
(02:44-06:36) Was ist Altern überhaupt?
(06:37-09:44) Wie Fasten wirkt
(09:45-12:10) Fasten verjüngt – bisher vor allem Tiere
(12:11-14:40) Wie man das Fasten beim Menschen erforscht
(14:41-18:56) Die unmögliche Kolumnne: Leben moderate Trinker länger?
(18:57-26:01) Frühstück oder nicht: Die beste Art zu fasten
(26:02-26:49) Mehr Wissen
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT-WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
-
Rauchen ist tödlich, das wissen alle. Wer lange raucht, stirbt häufig an
Herzinfarkt, Lungenkrebs oder anderen Herz- oder Lungenleiden. Unser
Gesundheitsredakteur Tom Kattwinkel ist einer Theorie nachgegangen, die
unter seinen rauchenden Freunden verbreitet war: Mit 30 aufhören, dann
geht das noch gut.
Ein Blick in Studien hat gezeigt, da ist tatsächlich was dran.
Wer jung ist, raucht häufig nicht mehr, sondern nutzt Vapes oder
Tabakerhitzer. Für solche neueren Produkte gibt es zwar noch nicht die
Langzeitdaten, die so klar den Schaden von normalen Zigaretten zeigen.
Doch für deren Wirkung im Körper haben Mediziner bereits klare Hinweise
gefunden (19:59).
Christoph Drösser fragt sich in seiner Kolumne, warum manche Menschen
eher nikotinabhängig werden als andere (23:13).
Shownotes:
- Mit 30 höre ich auf. Der Text von unserem Gesundheitsredakteur Tom
Kattwinkel auf ZEIT ONLINE.
- Der Tabakatlas, herausgegeben vom Deutschen Krebsforschungszentrum.
- Studie: Raucher haben ein dreifach erhöhtes Sterberisiko.
- Studie: Wer zwischen dem 25. und 35. Geburtstag aufhört, lebt zehn
Jahre länger als langjährige Raucher – zumindest statistisch.
- Studie: Nach einem Rauchstopp nimmt die Zahl der Mutationen im
Erbgut von Lungenzellen ab.
- Vier junge Raucher erzählen, warum sie angefangen haben. Niko Kappel
hat zugehört.
- Studie: Das US-Krebsforschungszentrum NCI trug in einem weltweit
viel beachteten Bericht alle bekannten Beweise für die Wirkung von
Werbung auf das Rauchverhalten zusammen.
Wir freuen uns über Kritik, Lob und Themenwünsche an
[email protected].
[ANZEIGE] Mehr über die Angebote unserer Werbepartnerinnen und -partner
finden Sie HIER.
[ANZEIGE] Wenn Sie uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchten,
testen Sie jetzt das ZEIT-WISSEN-Magazin im Vorteilsabo.
- もっと表示する