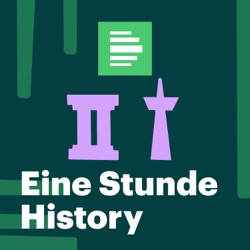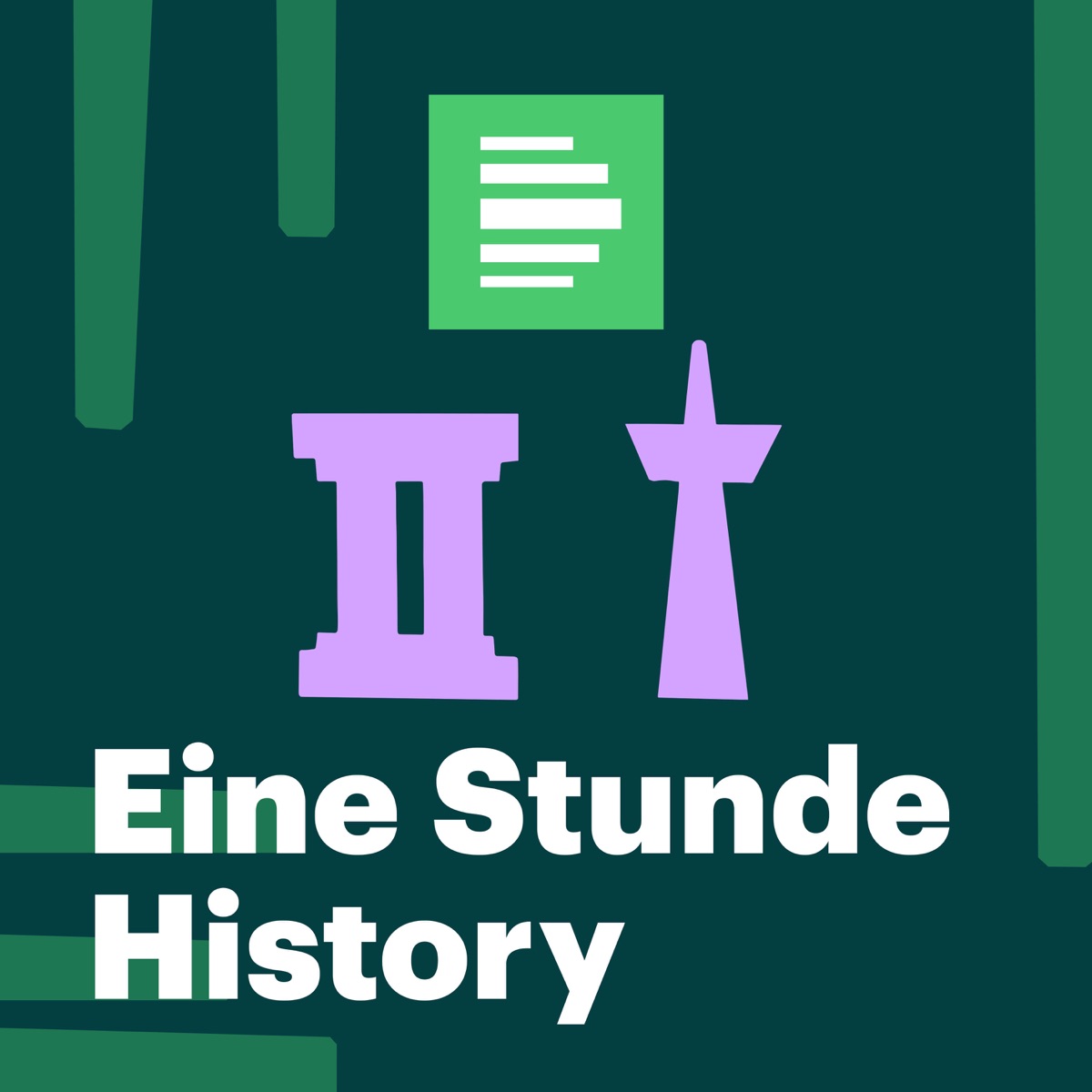Folgen
-
Wenige Wochen nach ihrer Geburt ist Katharina von Medici eine wohlhabende Vollwaise. Sie wächst als Schützling des Papstes Leo X. auf, der gleichzeitig ihr Großonkel Giovanni von Medici ist. Durch ihre Heirat mit Heinrich II., dem späteren französischen König, gewinnt sie an Macht und Einfluss.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:12:26 - Historiker Ulrich Niggemann über Katharina von Medicis Rolle als französische Königin
00:25:31 - Volker Reinhardt über den Clan der Medicis und ihren Einfluss auf ihre Zeit
00:36:15 - Historikerin und Autorin Martha Schad erläutert, wie sich Katharina von Medici und andere Frauen in der von Männern dominierten Welt durchgesetzt haben.
**********
Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:
Bedeutende Herrscherinnen: Königin Elisabeth I. von EnglandBedeutende Herrscherinnen: Margarethe I. Königin von Dänemark, Norwegen und SchwedenBedeutende Herrscherinnen: Queen Victoria als Namensgeberin des Victorianischen Zeitalters**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Der Streit um Zypern ist bis heute ungeklärt. Sowohl Griechenland als auch die Türkei beanspruchen die Insel für sich. Die Teilung der Insel in einen griechischen und einen türkischen führte kurzzeitig sogar zu kriegerischen Auseinandersetzungen.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:10:10 - Türkeiexperte Maurus Reinkowski über die politischen Ziele und Motive der türkischen Regierung während der Zypernkrise 1974
00:20:10 - Ionnis Zelepos von der Universität Ioannia über die griechischen Sichtweise der Ereignisse auf Zypern im Sommer 1974
00:32:50 - Hubert Faustmann, Direktor der Friedrich-Ebert-Stiftung in Nikosia, über das Verhältnis der beiden Bevölkerungsgruppen heute
**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Fehlende Folgen?
-
Früher zum Schutz von reisenden Frauen und Mädchen vor Missbrauch gegründet, bieten sie heute Reisenden Orientierung und helfen Obdachlosen mit einer warmen Mahlzeit und sanitären Einrichtungen. 1894 wurde die erste Bahnhofsmission gegründet.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:11:50 - Der Vorsitzende der deutschen Bahnhofsmission, Bruno Nikles, erläutert Geschichte und Entwicklung der Bahnhofsmission in Deutschland.
00:22:38 - Die Althistorikerin Christine Walde berichtet über Lebenshilfe und soziale Arbeit in der Antike.
00:33:46 - Karin Sturznickel-Holst ist Leiterin der ökumenischen Bahnhofsmission in Kassel und schildert den Alltag in einem deutschen Bahnhof.
**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:08:40 - Steffen Siegel, Experte für die Geschichte der Photographie von der Essener Folkwang Universität
00:17:10 - Benno Nietzel, Historiker, Ruhr-Universität Bochum
00:22:10 - Annette Vowinckel, Privatdozentin, Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam
00:38:30 - Jochen Spangenberg, Journalist
**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Nach über 2000 Jahren Vertreibung zurück nach Palästina: Diesen Wunsch nach einem jüdischen Staat formulierte Theodor Herzl. Der österreich-ungarische Publizist begründete damit den politischen Zionismus. Die Nationalbewegung hat Auswirkungen bis heute.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:10:04 - Der Münchener Historiker Michael Brenner beschreibt Theodor Herzl und den "Judenstaat"
00:21:53 - Andrea Livnat vom Onlineportal "haGalil" beschäftigt sich mit der Geschichte des Zionismus
00:34:53 - Tamar Amar-Dahl vom Greifswalder Wissenschaftskolleg erläutert die Bedeutung des Zionismus heute
**********
Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:
Rechtswissenschaft: Der Unterschied zwischen Kritik und Antisemitismus**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
In Europa und Deutschland werden rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien immer stärker. Die Stimmung im Land hat sich verändert, immer häufiger hört man die Sorge: "Das erinnert an Weimar!" Was das bedeutet, ist Thema in dieser Folge Eine Stunde History.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:06:11 - Fabian Virchow, Politikwissenschaftler
00:16:02 - Oliver Decker, Rechtsextremismusforscher
00:35:28 - Hendrik Cremer, Deutsches Institut für Menschenrechte
**********
Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:
Sachsen 1929: Erstmals große Zuwächse für die NSDAPRechtswissenschaft: So könnte die AfD die Schulen verändernParteiverbote: Vom Mumm, es zu tun, und der Weisheit, es zu lassen**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Sie sind der Willkür ihrer Grundherren ausgesetzt: Die Bauern werden in jeder Hinsicht ausgebeutet, um die Feudalgesellschaft aufrechtzuerhalten. Zölle, Steuern und unentgeltliche Frondienste treiben sie in die Verschuldung. 1524 kommt es dann zum Aufstand der Bauern.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:10:04 - Ralf Höller, Historiker
00:21:37 - Uwe Schirmer, Historiker
00:30:29 - David von Mayenburg, Rechtswissenschaftler
**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Er ist ein Politikum: Der erste Einsatz der Bundeswehr nach dem Zweiten Weltkrieg im Kosovo entzweit nicht nur die Partei Bündnis 90/Die Grünen, sondern ganz Deutschland.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:05:34 - Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Christine Werner blickt auf den Beginn der Luftschläge zurück
00:10:24 - Historiker und Kosovo-Experte Kurt Gritsch
00:21:21 - Militärhistoriker Hans-Peter Kriemann
00:32:18 - Ehemaliger Bundesaußenminister Jürgen Trittin
**********
Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:
Kosovo: Zehn Jahre Unabhängigkeit**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Mit einem Angriff dieses Ausmaßes hatten die Deutschen nicht gerechnet: Über 320.000 alliierte Soldaten stürmten am 6. Juni 1944 auf die Küste der Normandie zu. Der D-Day läutete den Beginn der Wende im Zweiten Weltkrieg ein.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:11:50 - Historiker Klaus Jürgen Bremm erläutert die Ereignisse des 6. Juni 1944 an der französischen Küste
00:24:05 - Militärhistoriker Peter Lieb beschreibt die Operation Overlord aus deutscher Sicht
00:35:40 - Medien und Propagandaexperte Clemens Zimmermann beschäftigt sich mit der Propaganda des NS-Regimes nach der Invasion
**********
Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:
8. Mai 1945: Sprechpause der GeschichteKalter Krieg: Die Gründung der Nato**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Johann Ohneland lag in der Thronfolge eigentlich sehr weit hinten – er wurde dann aber trotzdem König von England. Im Jahr 1215 unterschrieb er – wenn auch eher widerwillig – die Magna Carta. Bis heute ist sie die wichtigste Quelle des englischen Verfassungsrechts.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:10:40 - Der Heidelberger Historiker Jörg Peltzer beschreibt Johann Ohneland
00:20:50 - Matthias Waechter vom Institut Européen des Hautes Etudes Internationales in Nizza erläutert die Bedeutung Johann Ohnelands für die französische Geschichte
00:29:55 - Stephan Brun vom Deutschen Historischen Institut in London erklärt die Bedeutung der Magna Carta für die englische Verfassungsgeschichte
**********
Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:
Bedeutende Herrscherinnen: Königin Elisabeth I. von EnglandGlorious Revolution: Englands Revolution von 1688**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Am Ende des Ersten Weltkriegs erhält Griechenland als Bündnispartner der siegreichen Mächte ehemalige Gebiete des Osmanischen Reichs zugesprochen. Die Türken unter Kemal Atatürk kämpfen gegen die Besatzer, und für beide Seiten beginnt ein blutiger Krieg.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:12:05 - Der Istanbuler Turkuloge und Historiker Christoph K. Neumann schildert die Folgen des Krieges für die Türkei und für Griechenland.
00:22:02 - Historiker Ioannis Zelepos von der Universität Ioannia erläutert Inhalt und Ziel der "Megali Idea".
00:31:37 - Der Leiter des Dubliner Zentrums für Kriegsstudien, Robert Gerwarth, befasst sich mit dem türkisch-griechischen Verhältnis in der Gegenwart.
**********
Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:
Armenien: Der Völkermord von 1915/1916Eine Stunde History: Ein gespaltenes LandErster Weltkrieg: Der erste globale Krieg der WeltgeschichteEnde des Ersten Weltkriegs 1918: Der Frieden, der keiner war**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Bei den Landtagswahlen in Sachsen am 12. Mai 1929 konnte die NSDAP ihren Stimmenanteil verdreifachen. Die Aufregung darüber hielt sich in Grenzen. Doch der Schein trügt, denn das politische System geriet mit dem Erfolg der NSDAP ins Wanken.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:11:15 - Felix Kellerhof darüber, warum die NSDAP gewählt wurde
00:22:28 - Mike Schmeitzner beschreibt die sächsische NSDAP von 1929 bis 1945
00:33:06 - Patrick Bahners beschäftigt sich mit der Frage, ob die Wahlen 1929 und 2024 Parallelen aufweisen
**********
Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:
Weimarer Republik: Gründung der NSDAPGescheiterte Aufklärungsarbeit: Vom erfolglosen Kampf der SPD gegen die Nazis in den 1930ernNationalsozialismus: Wie die Demokratie abgeschafft wurde**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Am Ende des Ersten Weltkriegs ist aus Wien, einer der führenden Metropolen Europas, eine Stadt mit tausenden Flüchtlingen und großer Not geworden. Nach den Gemeinderatswahlen startet ein soziales Projekt, das der Stadt den Beinamen "Rotes Wien" beschert.
**********
Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:
Ende des Ersten Weltkriegs 1918: Der Frieden, der keiner warErster Weltkrieg: Der erste globale Krieg der WeltgeschichteErster Weltkrieg: Kriegsgefangene im Europa des Ersten WeltkriegsErster Weltkrieg: Schlacht von Verdun**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Jewgeni Prigoschin wächst arm auf und wird früh kriminell. Später steigt er als Caterer zum "Koch des Kreml" auf. Mit seinem Vermögen gründet er seine Privatarmee Gruppe Wagner. Drohgebärden gegenüber Putin werden ihm später wohl zum Verhängnis.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:11:50 - DLF-Korrespondent Florian Kellermann
00:21:20 - Politikwissenschaftler Andreas Heinemann-Grüder
00:30:30 - Historiker Robert Rebitsch
**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Vor 50 Jahren, im Jahr 1974, erschütterte die Guillaume-Affäre die Bundesrepublik Deutschland. Bundeskanzler Willy Brandt musste im Zug der Enthüllungen zurücktreten. Der DDR-Spion Guillaume hatte es als SPD-Mitglied bis ins Bundeskanzleramt geschafft.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:12:10 - Verfassungsschützer Helmut Müller-Enbergs über den Fall Guillaume
00:25:56 - Historikerin Kristina Meyer über den Rücktritt Willy Brandts
00:39:02 - Historiker Eckard Michels zu den Folgen der Spionage-Affäre
**********
Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:
Eine Stunde History: Grundlagenvertrag von 1972**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Elisabeth ist die Tochter des englischen Königs Heinrich VIII. und Anne Boleyn. Nachdem ihr Vater seine Frau hinrichten lässt, wird Elisabeth für illegitim erklärt. Sie schafft es später dann doch noch auf den Thron und legt als Königin Elisabeth I. den Grundstein für das britische Weltreich.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:10:20 - Der Autor Thomas Kielinger hat eine Biographie über Elisabeth geschrieben und berichtet über wesentliche Daten ihres Lebens.
00:20:04 - Der Historiker Jürgen Klein beschreibt das so genannte "Elisabethanische Zeitalter" mit dem die Regierungszeit Elisabeths I. umschrieben wird.
00:31:18 - Die Hamburger Historikerin Claudia Schnurmann erläutert wie es zum britischen Weltreich kam, das seine ersten Anfänge unter Elisabeth I. nahm.
**********
Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:
Großfürst Iwan III. - Moskau als "Drittes Rom"Dschingis Khan: Das Weltreich der MongolenRömisch-deutscher Kaiser: Die Krönung Karls des Großen**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Vor dem Ersten Weltkrieg geht das Deutsche Reich verschiedene Bündnisse ein. Der "Erzfeind" Frankreich bleibt davon ausgeschlossen und schließt daraufhin 1904 ein Abkommen mit Großbritannien ab. Aus der "Entente Cordiale" wird die "Triple Entente", als Russland hinzukommt. Deutschland fühlt sich dadurch umzingelt und rüstet auf.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:13:03 - Historiker Jörn Leonhard
00:23:40 - Historiker Eckhart Conze
00:33:42 - Historiker Rainer F. Schmidt
**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Die Nato, also der Nordatlantikpakt, ist ein Verteidigungsbündnis, zu dem aktuell 32 Länder gehören. Jüngstes Mitglied ist Schweden. Vor 75 Jahren, am 4. April 1949, wurde die Nato gegründet.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:11:01 - Politikwissenschaftler Falk Ostermann über die Gründung der Nato
00:21:48 - Sicherheitsexperte Frank Umbach zum Warschauer Pakt
00:34:04 - Politikwissenschaftler Gunther Hauser zu künftigen Herausforderungen des Bündnisses
**********
Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:
Nato-Norderweiterung: Weg frei für Schweden und Finnland**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Es gibt kaum eine Frau in der Geschichte Skandinaviens, die mehr Einfluss und Macht hatte als Margarethe I. 1375 tritt sie ins Rampenlicht, nachdem ihr Vater König Waldemar IV. im Alter von 55 Jahren stirbt.
**********
Ihr hört in dieser "Eine Stunde History":
00:10:27 - Der Historiker Oliver Auge beschreibt die Persönlichkeit von Margarethe I. als mächtige Herrscherin über drei Königreiche in Skandinavien.
00:19:47 - Der Historiker Robert Bohn beschäftig sich mit der Kalmarer Union, die in Konkurrenz zur Handelsorganisation der Hanse stand.
00:30:12 - Der Historiker Martin Krieger ordnet die Bedeutung Margarethes I. in der skandinavischen und europäischen Geschichte ein.
**********
Mehr zum Thema bei Deutschlandfunk Nova:
Bedeutende Herrscherinnen: Queen Victoria als Namensgeberin des Victorianischen ZeitaltersRömisch-deutsches Kaiserreich: Die Krönung von Otto I.Schlacht bei Hastings: Harald II. gegen Wilhelm der Eroberer**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
-
Die Schaffung eines Bürgerlichen Gesetzbuchs, das die persönlichen Freiheiten, die Gleichheit vor dem Gesetz sowie die Trennung von Kirche und Staat festschreibt, ist eine der wesentlichen Forderungen der Französischen Revolution von 1789. Umgesetzt hat sie Napoleon I.
**********
Den Artikel zum Stück findet ihr hier.
**********
Ihr könnt uns auch auf diesen Kanälen folgen:Tiktok und Instagram.
- Mehr anzeigen